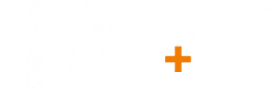Ökonomie im Kreislauf
Wie sich gemeinwohl-orientierte Betriebe zertifizieren
Christian Felber, Gemeinwohl-Ökonomie, Sepp Eisenriegler, R.U.S.Z
Kurz & Bündig
Christian Felber, Initiator der GemeinwohlÖkonomie, legt zusammen mit einer am Gemeinwohl orientierten Firma dar, wie eine Zertifizierung eines Unternehmens nach objektiven Kriterien der Ökologie, des Sozialen aussehen kann. Seine Idee der Gemeinwohl-Ökonomie findet nun auch auf europäischer Ebene Beachtung.
Die 2010 gestartete Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie möchte eine ethische Kreislauf-Marktwirtschaft etablieren. Neben den Grundwerten Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit beruht sie auf tiefer Nachhaltigkeit und der Achtung vor dem Leben.
Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge wünschen sich bereits 88 Prozent der Menschen in Deutschland und 90 Prozent in Österreich eine „neue Wirtschaftsordnung“. Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein innovatives Wirtschaftsmodell, das sich seit 2010 von Österreich, Bayern und Südtirol aus weltweit ausbreitet. Bisher haben 600 Unternehmen eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt, aktuell schließen sich immer mehr Kommunen, Städte und auch schon Landkreise an. Die tragenden Säulen der Gemeinwohl-Ökonomie sind dabei nicht „neu“, sondern zeitlose Ziele und Verfassungswerte. Die Bayerische Verfassung besagt: „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ (Art. 151) Das deutsche Grundgesetz sieht vor, dass „Eigentum verpflichtet“ und „sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll“ (Art. 14). Die Bewegung versteht unter Gemeinwohl zunächst die Summe der Verfassungswerte: Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Demokratie oder eben auch Nachhaltigkeit. Das Wirtschaftsverständnis ist ein ökologisch-systemisches und ethisches: Der Natur wird ein eigener Wert zugestanden, die planetaren Grenzen sollen zu den Grenzen der Wirtschaftsfreiheit werden und Externalitäten zur Insolvenz der Unternehmen führen. Schlüsselinstrument ist dabei eine unternehmerische Gemeinwohl-Bilanz. Diese bewertet auf Basis eines formalen GemeinwohlBerichts den Beitrag einer Organisation zu den oben genannten Grundwerten. Zwanzig Themen (zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette) werden in 55 konkrete Aspekte aufgeschlüsselt, die in vier Erreichungsstufen bewertet werden. Maximal können so 1.000 Gemeinwohl-Punkte erreicht werden. Neben Positivpunkten gibt es auch Negativaspekte wie zum Beispiel die Verletzung der Menschenrechte in der Zulieferkette, die Nutzung von Steueroasen oder geplante Obsoleszenz. Nach Vorstellung der GWÖ sollen bessere Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnisse zu geringeren Steuern und Krediten, Vorrang im öffentlichen Einkauf und freien Handel führen und umgekehrt. Dadurch würde die heutige Systemdynamik, das Externalisieren und das Auslagern von Kosten auf zukünftige Generationen, korrigiert: Das Externalisieren von Nutzen wird belohnt, das von Kosten bestraft. Ziel ist, dass klimafreundliche, nachhaltige und verantwortliche Produkte preisgünstiger für die Endverbraucher werden als weniger nachhaltige und ethische Produkte und Wirtschaftspraktiken. In der Wertspalte Ökologie werden u. a. nahe und resiliente Wirtschaftsstrukturen, das Vermeiden von Transport und Abfällen, Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit belohnt. Die Pionierunternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie kommen zum Teil aus den nachhaltigen Branchen von der Biolandwirtschaft über Erneuerbare Energien bis zum Fairen Handel. Es sind auch klassische Unternehmen gemeinwohl-bilanziert, wie Banken oder eine Betriebskrankenkasse. Alle bemühen sich, auf Ökostrom umzusteigen, zu ethischen Banken zu wechseln, den öffentlichen Verkehr zu fördern und fleischarme Ernährung anzustreben. Bei den produzierenden Unternehmen spielen Cradle-to-Cradle und Kreislaufökonomie eine entscheidende Rolle, zum Beispiel bei der Druckerei Gugler im österreichischen Melk oder beim Holzbauunternehmen Thoma in Goldegg.

Beispiel R.U.S.Z
Eines der GWÖ-Unternehmen, das direkt zum Thema Kreislaufökonomie arbeitet, ist das Soziale Unternehmen Reparatur- und ServiceZentrum R.U.S.Z in Wien, das vor 22 Jahren von Sepp Eisenriegler gegründet wurde. Die Abkürzung R.U.S.Z steht für Reparatur- und Service-Zentrum. Mittlerweile werden dort über 9.000 Reparaturen im Jahr durchgeführt – von der Waschmaschine bis zum Dunstabzug „fast alle Geräte, durch die Strom fließt“. Die R.U.S..-Techniker kommen aber auch ins Haus, um Waschmaschinen & Co zu reparieren. Weiters gibt es Geräte, die geliehen und damit genutzt statt besessen werden können. In seinen Anfängen verknüpfte Eisenriegler soziale, arbeitsmarktpolitische Bedürfnisse mit ökologischen Zielen: 300 Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung und Haftentlassene, die am ersten Arbeitsmarkt wenig Chancen hatten, konnten fachlich ausgebildet und in Regelarbeitsjobs vermittelt werden. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Wiener Arbeitsmarktservice AMS 2007 führte Eisenriegler das R.U.S Z auf eigenes Risiko weiter und gründete einen eigenständigen Mechatroniker-Fachbetrieb. Er bildet BFI-Lehrlinge kostenfrei aus, macht Arbeitslose fit für den beruflichen Wiedereinstieg bzw. gibt Flüchtlingen unbefristete Jobs. Es war nicht immer kostendeckend – wenn man so will, ist es die längste Zeit Liebhaberei gewesen. Jedoch Stillstand kennt der 67-Jährige nicht. Inzwischen ist R.U.S.Z das größte Re-Use-Zentrum für Haushaltsgroßgeräte in Österreich. Im zugehörigen ReparaturCafé „Schraube 14“ werden Interessierte bei der Reparatur von eigenen Geräten unterstützt. Zusammen mit seinen Kunden nimmt Eisenriegler bewusst auch politische Verantwortung wahr: Eisenriegler rief gemeinsam mit anderen Reparaturbetrieben im Großraum Wien das ReparaturnetzWerk Wien und das Demontageund Recycling-Zentrum DRZ ins Leben. Er ist Mitbegründer des Europäischen Dachverbandes für sozialwirtschaftliche Betriebe RREUSE und des Bundesdachverbandes RepaNet Österreich, einem Verein von gegenwärtig 36 sozialintegrativen Re-Use-Betrieben. Sein Einsatz für praktisch gelebte Kreislaufwirtschaft gipfelte in der Festschreibung der ONR 192102:2014 „Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte elektrische und elektronische Geräte“, die weltweit einzigartig ist. Österreich nimmt seither die Vorreiterrolle auch auf europäischer Ebene im Bereich „ReUse“ ein. Das R.U.S.Z-Geschäftsmodell entspricht seit der Gründung im Jahr 1998 zur Gänze dem Kreislaufwirtschaftspaket der EU und auch dem von der EU-Kommission am 11. März 2020 veröffentlichten Aktionsplan der Europäischen Kommission für die Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan (CEAP). R.U.S.Z erbringt so einen Mehrwert für das Gemeinwesen auf sozialer und ökologischer Ebene und unterstützt auch die UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (insbesondere die SDGs 8, 12 und 13).

Politische Umsetzung
Die Gemeinwohl-Ökonomie hat sich seit 2010 in 30 Staaten weltweit ausgebreitet. Allein in Deutschland gibt es 70 Regionalgruppen, 600 Unternehmen haben eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt. Neben Wirtschaftsunternehmen schließen sich auch immer mehr Kommunen der Bewegung an. Dabei gibt es regionale Schwerpunkte. Die Stadt Stuttgart hat erste kommunaleigene Betriebe bilanziert. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert ebenso wie die Stadt Barcelona oder Wien die Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz durch private Unternehmen. Auf Antrag des Bündnis 90/Die Grünen wurde die Gemeinwohl-Bilanz in Baden Württemberg und Hessen ins Regierungsprogramm aufgenommen. Im Deutschen Bundestag wird aktuell ein Antrag zur GemeinwohlBilanzierung eines Bundesbetriebs diskutiert. Auf EU-Ebene hat der Wirtschafts- und Sozialausschuss eine Initiativstellungnahme mit 86 % der Stimmen angenommen und die GWÖ für den Einbau in das Rechtssystem der EU empfohlen. Erster Anknüpfungspunkt ist die so genannte NFI-Richtlinie, die größere Unternehmen verpflichtet, neben der Offenlegung einer Finanzbilanz auch nichtfinanzielle Informationen zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz, Arbeit- und Menschenrechte, Diversität und Antikorruption offenzulegen. Die GWÖ-Bewegung arbeitet an der Gleichstellung der Gemeinwohl- mit der Finanzbilanz. Die vorhandenen Nachhaltigkeitsbericht-Rahmenwerke sollen zu einem gesetzlichen Standard vereinheitlicht und dieser extern auditiert werden. Das Ergebnis des quantifizierten Audits (z. B. in Gemeinwohl-Punkten) könnte dann zu den empfohlenen Rechtsfolgen führen, wodurch langlebige, modulare, wiederverwertbare, biologisch abbaubare und Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen systematisch zum Einsatz kämen. Die Spielregeln für die Marktwirtschaft würden so gelegt, dass aus einer Wegwerf- und Wachstumsgesellschaft eine nachhaltige Kreislaufökonomie würde.