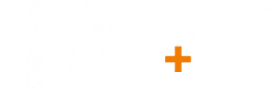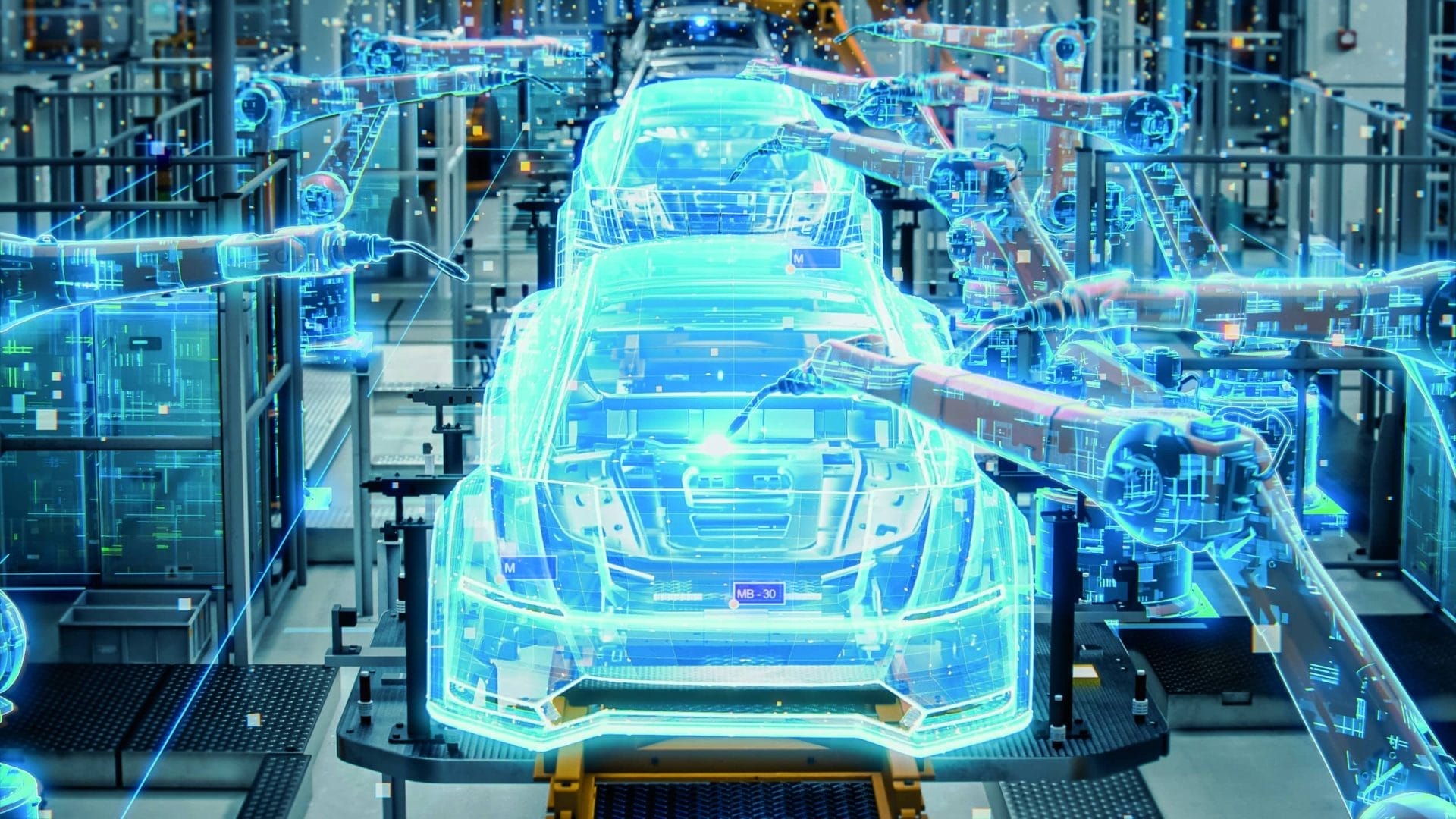Die (Un)sichtbarkeit der alltäglichen Energienutzung
Potentiale und Herausforderungen smarter Energie
Kerstin Walz, Anita Engels, Universität Hamburg
Kurz und bündig:
Im Hamburger Stadtteil Lokstedt analysierten Wissenschaftler, welche Ansatzpunkte es für den Klimaschutz im Haushalt geben könnte – zusammen mit der Verwaltung, den Bewohner*innen und Expert*innen. Dabei erschien der Einsatz von intelligenten Technologien und Vernetzungen vor allem dann vielversprechend, wenn dadurch die Unsichtbarkeit von Infrastrukturen aufgebrochen sowie die Kontroll- und Teilhabemöglichkeit derBewohner*innen gestärkt wird
Angesichts der Smartifizierung von Alltagswelten stellt sich die Frage, wie
intelligente Technologien jenseits des Expertendiskurses aufgenommen werden. Anhand von zwei Beispielen im Bereich Haushaltsenergie –intelligente Verbrauchsanzeigen und Mieterstrom – wird diskutiert, wie Alltagserfahrungen in Wechselwirkung mit technologischen Entwicklungen treten können. Wichtig für die Digitalisierung der Alltagswelt ist es, die Unsichtbarkeit von Infrastrukturen aufzubrechen und die Kontrollmöglichkeiten der Nutzer*innen zu vergrößern.