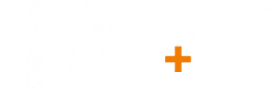Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift?
Fußball und das Tor zur Digitalisierung
Im Gespräch mit Jochen Drees, DFB Schiri GmbH
(Titelbild: ©Adobe Stock | 206928533 | Panumas)
Kurz und Bündig
Der VAR hebt Entscheidungen im Fußball auf das nächste digitale Level. Doch seit der Einführung ist die Technologie umstritten. Die Grenzen liegen in der Verknüpfung des Digitalen mit dem Analogen. Transparenz, Aufklärung und eine gute Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter:innen sind das Rezept für den gewinnbringenden Einsatz neuer Technologien im Fußball.
Der deutsche Fußball ist offen für Innovation und Digitalisierung. Verantwortlich dafür ist er: Dr. Jochen Drees, Leiter des Bereiches Technologie und Innovation der DFB Schiri GmbH. Im Gespräch mit der IM+io reflektiert der ehemalige Mediziner und langjährige Top-Schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bundes die Einführung des Video Assistant Referee (VAR) kritisch. Doch das Ende der Digitalisierung in der Deutschen liebstem Sport ist noch lange nicht erreicht.
IM+io: Herr Dr. Drees, Sie waren als Mediziner tätig, bevor Sie diesen Beruf vor ein paar Jahren aufgegeben haben und zur DBF Schiri GmbH gewechselt sind. Warum haben Sie diesen Wechsel vollzogen?
JD: Das hatte vielfältige Gründe. Ich habe in einer hausärztlichen Praxis mit zwei Kollegen gearbeitet
und beide haben dann ihre Tätigkeit beendet – einmal aus Altersgründen, einmal aus privaten Gründen – und dann war ich alleine in der Praxis und konnte das Pensum an Patientinnen und Patienten sowie deren Betreuung in gleicher Art und Weise wie vorher nicht aufrechterhalten. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, dass ich an meine persönlichen Grenzen komme und schauen musste, dass ich etwas verändere. Der Ansatz war am Anfang nicht, den Arztberuf aufzugeben, sondern eher in der Praxis selbst Veränderungen vorzunehmen, also zum Beispiel neue Kolleginnen oder Kollegen zu gewinnen und die Arbeitslast wieder auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist nicht gelungen, weil es im Moment schwierig ist, junge Menschen für den Arztberuf zu begeistern, denn dieser ist leider unattraktiv geworden. Parallel zu diesen Entwicklungen, wie es
manchmal im Leben ist, kam die Anfrage des DFB. Insgesamt war es ein langwieriger Prozess mit vielen Gesprächen. Ich habe es dann irgendwann als ein Privileg verstanden, das machen zu dürfen und noch einmal die Chance zu bekommen meinem beruflichen Leben erneut eine andere Richtung zu geben. Dazu muss man wissen, dass ich selbst über viele Jahre Schiedsrichter war und auch in der Bundesliga gepfiffen habe. Es bestand also immer eine enge Anbindung an die Schiedsrichterei. Irgendwann habe ich zusammen mit meiner Frau entschieden, dass ich diesen Schritt unternehme. Und ich muss sagen, dass ich trotz aller Herausforderungen, die mit meiner aktuellen Tätigkeit verbunden sind, den Schritt bis jetzt nicht bereut habe.
IM+io: Sie haben sich beim DFB einem spannenden innovativen Projekt gewidmet, nämlich der
Video-Assistenten-Technologie. Sind Sie mit der Umsetzung zufrieden oder sehen Sie bislang ungenutzte Potenziale dieser Technologie?
JD: Es gibt immer etwas zu verbessern und Dinge, in denen man sich entwickeln muss, nach meinem Verständnis. Man darf nie aufhören zu denken und nie mit dem zufrieden sein, was man erreicht hat. Meiner ‚Auffassung nach liegt das hauptsächliche Problem beim Video-Assistant-Referee (VAR) liegt in der öffentlichen Akzeptanz, weniger in der inhaltlichen Arbeit. Inhaltlich, denke ich, sind wir ganz gut dabei und haben bereits vieles erreicht. Die Technologie hat natürlich auch ihre Grenzen, wenn ich sie im Fußball einsetze. Fußball ist eben kein digitaler Sport und Fußball ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass ich alles in schwarz oder weiß entscheiden kann. Wir haben viele Ermessensentscheidungen, die sich nicht immer in richtig und falsch einordnen lassen. Es kommt immer mal wieder auf die Perspektiven und Sichtweisen an. Und da stößt ein digitales System an Grenzen, wenn es darum geht, das erfassen und einordnen zu können. Außerdem werde ich es nie schaffen im Fußball jede Person von einer Entscheidung überzeugen zu können, weil einfach sehr viele Emotionen im Spiel sind. Eine Mannschaft wird natürlich immer aus einer bestimmten
Perspektive auf eine Entscheidung schauen und nicht unbedingt objektiv sein. Es gibt also eine Diskrepanz in der Wahrnehmung. Mit dem Blick auf das, was das System eigentlich leistet und leisten kann, muss ich sagen sind wir auf einem guten Weg. Es ergeben sich im technologischen Bereich immer wieder neue Ansätze und im Hintergrund laufen Tests, um festzustellen ob uns Dinge weiterbringen können und einen Nutzen für den Fußball haben. Vieles davon versandet wieder und manches kommt dann tatsächlich in die Anwendung. Es ist ein System, bei dem ich den Eindruck habe, dass es nie stillsteht.
IM+io: Sie haben selbst die Herausforderung angesprochen beim Projekt VAR alle beteiligten Personen mitzunehmen und Akzeptanz zu schaffen. War dies das größte Problem bei der Einführung der VAR-Technologie im Fußball? Und konnten Sie weitere sportspezifische Herausforderungen identifizieren?
JD: Ich würde sogar sagen, dass es einer der größten Fehler war bei der Einführung des VAR davon auszugehen, dass diese Einführung einfach so von allen Beteiligten im Umfeld akzeptiert wird. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat man es sich zu einfach gemacht. Man hätte viel mehr Informationen und Erklärungen dazu verbreiten müssen, um so die Menschen mitzunehmen. Man hat einfach gesagt: „Wir machen das jetzt und alles wird gut!“. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass dieses Vorgehen viele Personen enttäuscht hat, die Technologie zu abstrakt geblieben ist und die Betroffenen sich nicht vorstellen konnten, was da eigentlich passiert. Ich erlebe es noch heute, nach sechs Jahren, dass Menschen Probleme damit haben die Basics des VAR zu verstehen und Missverständnisse auftreten. Das kann man nicht nur auf die jeweilige Person schieben, sondern man muss die Verantwortung auch bei sich selbst suchen. Seit ich in der Verantwortlichkeit bin, versuchen wir immer wieder, Informationen zu transportieren, aufzuklären und zu demonstrieren, was wir tun, um ein Verständnis aufzubauen. Aber, wenn man einer solchen Entwicklung hinterherläuft, hat man immer schlechte Karten. Es gibt Menschen, die haben dicht gemacht und lassen das Thema auch nicht mehr an sich heran. Hier ist es dann extrem schwierig einen, Imagewandel zu vollziehen. Wir
können nur immer wieder versuchen, die Benefits herauszustellen und den Nutzen der Technologie zu belegen. Die Aufgabe, Menschen nun umzustimmen und wiederzugewinnen, ist ungemein schwieriger, als wenn man sie von Anfang an hätte mitnehmen können. Daher war und ist es noch immer das größte Problem bei der Einführung des VAR. Sportspezifisch ist die größte Herausforderung meines Erachtens, dass wir eben keinen digitalen Sport ausüben und uns eher in
einer analogen Welt bewegen, in der es richtige und falsche Entscheidungen der Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter gibt, ebenso wie Ermessensentscheidungen, die man nicht oder nur schwer digital abbilden kann. Zusätzlich suggeriert der Einsatz der VAR, dass es sich um eine rein digitale Entscheidungsfindung handelt. Doch das ist es letztlich nicht. Wir haben Situationen, die wir klassisch klären können über schwarz/weiß. Also zum Beispiel die Frage, ob der Ball im Tor war oder nicht. Diese Situation können wir über die Torlinientechnologie eindeutig klären. Beispielsweise wir haben aber auch Situationen, bei denen das Ermessen desjenigen reinspielt, der vor der Technologie sitzt, also mit ihr arbeitet und dann doch wieder eine subjektive Komponente einbringt. Und dieses vernünftige Vermischen von digitaler und analoger Welt ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung einer solchen Technologie.
IM+io: Überall dort, wo Menschen an Entscheidungen beteiligt sind und Regeln auslegen, wird es unterschiedliche Betrachtungsweisen geben. Das ist auch die Erfahrung die Sie ebenso wie
Trainer:innen, Spieler:innen und Fußballfans mit der VAR-Technologie machen. Sollte die Konsequenz
also lauten, alle Entscheidungen in Zukunft durch Computer und künstliche Intelligenz treffen und den Menschen außen vor zu lassen?
Wäre das Resultat ein zu 100 Prozent faires Spiel?
JD: Ich glaube, dass die KI auch vor dem Fußball nicht Halt machen wird und wir in den nächsten
Jahren Möglichkeiten sehen werden sie einzusetzen. Gleichzeitig ist auch der Wunsch da, im Fußball
Graubereiche bei Entscheidungen so klein wie möglich zu halten. Das kann durch den Einsatz von datenbasierten Technologien gelingen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man letztendlich dennoch nicht jede Situation auf dem Spielfeld einer gerechten Lösung für alle Personen zuführen kann. Fußball bleibt ein emotionaler Sport, bei dem alle Beteiligten aus einer bestimmten Richtung auf das Spiel und die darin getroffenen Entscheidungen schauen. Selbst wenn eine KI Entscheidungen auf
Grundlage von definierten Regeln und Erfahrungswerten aus der Datenbasis treffen würde, bliebe immer ein Rest an Kritikern und Menschen, für die die Entscheidung falsch wäre. Man muss auch immer den Leitgedanken des Sports im Kopf haben und darf die Natur des Spiels nicht aus den Augen verlieren. Fußball muss weiterhin Emotionen transportieren können. Und Fußball darf, genauso wie die Schiedsrichtertätigkeit, nicht den Anspruch haben, in jeder Situation zu 100 Prozent korrekt zu sein. Daher muss bei jeder Entscheidung für eine neue Technologie die Frage gestellt werden, ob dadurch der Grundgedanke des Spiels verändert wird und worin der Nutzen liegt.
IM+io: Emotionen sind ein gutes Stichwort. Gegnerinnen und Gegner des VAR beklagen den Verlust von Emotionen im Spiel durch den Zeitverzug, bis zum Beispiel Tore gelten. Was entgegnen Sie?
JD: Ich muss sagen, dass ich noch keinen Spieler und auch keine Spielerin gesehen habe, der oder die nach Torerzielung keine Emotionen gezeigt hätte. Aber ich kann nachvollziehen, dass es zu
Verärgerung führt, wenn Prüfungssituationen zu lange dauern. Ich würde aber sagen, dass sich
durch die Überprüfung des Tors ein neuer Spannungsbogen aufbaut, bis klar ist, ob der Treffer der Überprüfung im Hintergrund Stand gehalten hat. Die einen stöhnen auf, weil das Tor vielleicht doch nicht zählt und die anderen jubeln nun doch, weil ihre Mannschaft nicht in Rückstand geraten ist. Insofern sind die Emotionen im Spiel nicht gebremst, sondern nur verändert. Zeit ist aber ein extrem kritischer Faktor bei der Anwendung der VAR-Technologie. Daher versuche ich im Hintergrund immer den Zeitverzug beim Einsatz der Technologien zu minimieren. Dort, wo wir klassische Schwarz/Weiß-Entscheidungen treffen, gelingt uns das bereits sehr gut. Also zum Beispiel mit der Torlinientechnologie. Hier haben wir keinerlei Zeitverzug mehr und es ist absehbar, dass das auch für Abseitsentscheidungen umsetzbar werden wird. Gerade nach Torerzielung kommt es jedoch häufig zu zeitintensiven Prüfungen, wenn unmittelbar vor Torschuss zwei bis drei kritische Situationen und Pässe manuell angeschaut werden müssen, wie wir das im Moment noch tun. Die jungen Menschen, die als Videoassistentin oder -assistent arbeiten, geben bereits ihr Bestes. Wenn man mal erlebt hat, wie schnell im Kölner Keller gearbeitet wird, dann kann man keinen Vorwurf mehr erheben. Auf dieser Ebene können wir uns, meiner Meinung nach und unter dem Einsatz der aktuellen Technologien, nicht wesentlich verbessern. Ein größerer Zeitgewinn wäre nur durch den Einsatz anderer beziehungsweise neuer Technologien möglich – die teilweise auch bereits bei internationalen Verbänden eingesetzt werden – und da bin ich zuversichtlich, dass diese Entwicklungen in den nächsten Jahren auch in die Bundesliga Einzug halten werden.
IM+io: Ein weiterer Kritikpunkt ist die Intransparenz. Während die Zuschauer:innen zuhause am
Bildschirm sehr gut mitverfolgen können, warum welche Entscheidung getroffen wurde, werden die Stadionbesucher:innen aktuell außen vor gelassen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
JD: Aus meiner Sicht ist es, offen gesprochen, eine Katastrophe, dass die Besucherinnen und Besucher im Stadion nicht das Gleiche sehen können wie die Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm. Ich bin seit Jahren einer derjenigen, der sagt, dass es technisch möglich ist. Die Vereine können das. Wir können die Informationen, also das Bildmaterial, liefern. Aber wir kommen damit nur bis zum Stadion und sind dann abhängig davon, ob der betreffende Verein, also der Eigentümer des Stadions, willig ist, diese Informationen auf die Leinwand zu bringen. Daran scheitern wir seit ein paar Jahren, weil es ein paar Vereine gibt, die das nicht wollen. Und die Liga verfolgt den Ansatz, dass es entweder in allen Stadien diese Einspieler gibt oder eben in keinem. Es ist möglich und wir sehen das bei jeder Welt und Europameisterschaft. Und auch in anderen Nationalverbänden wurde das Einspielen der Videoinformationen erprobt und umgesetzt. Für mich ist es daher völlig unverständlich, warum es in Deutschland nicht funktionieren soll und warum man es nicht einfach ausprobiert, um zu
sehen, wie es wirkt und ankommt. Wie ist denn das Zuschauerverhalten aktuell im Stadion? Da gibt es ganz viele, die mit dem Handy in der Hand in der Kurve stehen und parallel das Spiel streamen, um Zugriff auf die Fernsehbilder und somit auf die gleichen Informationen wie die Fans am Bildschirm zu haben. Daher war eine weitere Überlegung, eine App zu bauen, die man sich aufs Handy laden
kann und womit man dann die Bildinformationen zur Verfügung gestellt bekommt. Allerdings sind hierbei in der Planungsphase zu viele Fragezeichen aufgetaucht, wie zum Beispiel die Akzeptanz der App bei den Zuschauenden, mögliche negative Veränderung des Stadion-erlebnisses, und vor allem die Bildrechteproblematik – also wer, wann und wo auf die Bildsequenzen zugreifen darf. All dies hat dazu geführt, dass diese Idee nicht weiter verfolgt wird und wir stattdessen nach anderen Optionen suchen. Primäres Ziel bleibt, den Zuschauenden im Stadion die relevanten Videosequenzen zukommen lassen zu können. Weiterhin Thema ist die öffentliche Verkündung von Schiedsrichterentscheidungen, wie wir sie auch bereits bei der FIFA Frauenfußball-WM und bei der U20 WM gesehen haben. Der internationale Verband hat gerade grünes Licht dafür gegeben, diese Vorgehensweise auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Das heißt, es gibt eine kurze Durchsage des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin über das Stadionmikrofon, in der die Entscheidung verkündet wird. Man muss sich dabei jedoch vergegenwärtigen, dass es sich auch hier erst um eine Information nach gefallener Entscheidung handelt und die Personen im Stadion noch nicht wissen oder anhand der Bilder nachvollziehen können, welche Situation aus welchem Grund strittig war.
Ich sage, solange wir die Bilder nicht auf die Leinwände kriegen und die Fans im Stadion im gleichen Moment die Information haben wie diejenigen, die zuhause am Fernseher zuschauen, wird man immer ein Ungleichgewicht in der Behandlung der beiden Personengruppen haben. Und das ist eigentlich im klassischen Sinne unfair.
IM+io: In Sachen Digitalisierung im Allgemeinen sind uns einige andere Nationen seit vielen Jahren
um einiges voraus. Der DFB war 2017 jedoch einer der ersten nationalen Fußballverbände, der die Innovation VAR umgesetzt hat. Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Faktor, um in Sachen Innovation und Digitalisierung eine Vorreiterrolle einnehmen zu können?
JD: Man muss grundsätzlich offen sein für neue Technologien. Denn wenn man im Vorhinein ablehnt, dann werde man nie irgendwelche Fortschritte erzielen. Wir würden heute nicht die Autos fahren, die wir haben, keine Mobiltelefone nutzen, denn alles ist geprägt von technologischen Entwicklungen. Und wenn man sich dem nicht öffnet, erst abwartet und schaut, was machen Andere damit, dann wird man immer das Problem haben, dass man der Entwicklung hinterherläuft. Etwas sofort in den Livebetrieb zu bringen, das ist auch klar, ist ebenfalls keine gute Möglichkeit. Denn ich muss in der Anwendung sicher sein und zunächst Vertrauen in die neue Technologie aufbauen. Aber wenn ich Neuem gegenüber aufgeschlossen bin und mich damit auseinandersetze und teste, dann wird man sehen, ob es klappt und es wird immer wieder Chancen geben, fortschrittlich zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sicherlich, immer offene Augen und Ohren zu haben und sich in der Welt umzuschauen. Was gibt es irgendwo anders? Wir stehen beispielsweise in regem Austausch zu befreundeten Verbänden, mit den Niederländern oder den Briten zum Beispiel, und bringen uns gegenseitig auf den neuesten Stand, nutzen Synergien. Und drittens finde ich den bekannten Blick
über den Tellerrand hinaus wichtig. Was gibt es in anderen Sportarten und mit wem kann man sich dazu austauschen? Wir sind immer wieder im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hockeysport und auch dem Basketball, um zwei Beispiele zu nennen. Und dann schaut man sich an, welche Technologien dort genutzt werden und was davon wir in welcher Weise auf den Fußball übertragen könnten.
IM+io: Ihre Formel für technologische Innovation im Sport lautet also: testen, Synergien nutzen und über den Tellerrand blicken. Kann man es so zusammenfassen?
JD: Ja, genauso lässt es sich zusammenfassen.
IM+io: Ist denn die Tätigkeit des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin durch die Einführung des VAR leichter geworden?
JD: Eigentlich ist es für die Kolleginnen und Kollegen schwieriger geworden, weil sie nun viel umfassender und komplexer ist. Wir haben in Deutschland die Herausforderung, dass wir neben reinen Videoassistent:innen auch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben, die auch auf dem Platz tätig sind. Das heißt, sie vollziehen regelmäßig einen Rollenwechsel. Das bringt neue Anforderungen an
die Kolleginnen und Kollegen mit sich. Hinzu kommt natürlich die Herausforderung, sich mit den Technologien vertraut zu machen und herauszufinden, was das System kann.
IM+io: Wie lange dauert die Ausbildung eines Videoassistenten beziehungsweise einer Videoassistentin?
JD: Ich würde sagen, die Ausbildung dauert circa ein halbes Jahr, wenn wir uns regelmäßig inhaltlich
treffen. Wir starten in der Regel mit drei Theorieeinheiten, die jeweils einen halben Tag dauern und in denen wir die Grundlagen besprechen: Wozu ist der VAR da? Was kann er und was kann er nicht? Und so weiter. Anschließend gehen wir in das Situationstraining rein. Zunächst theoretisch in Form von Videospielen. Wenn das abgeschlossen ist, ist der nächste Schritt die praktische Übunge anhand von Simulationen. Im letzten Schritt verfolgen die Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung live Spiele.
Wir haben in Köln im Videocenter die Möglichkeit, die Bild- und Toninformationen zum laufenden Spiel zu spiegeln, sodass die Personen, die sich in der Ausbildung befinden, die gleichen Szenen sehen und die gleichen Informationen bekommen wie die Kolleg:innen im Einsatz und aus deren Handlungen und Reaktionen lernen können. Sie können aber auch selbst mit dem System arbeiten, Perspektiven und Abspielgeschwindigkeiten wählen. So versuchen wir die Lernenden schrittweise auf den realen Einsatz vorzubereiten. Wobei neuausgebildete Videoassistent:innen zunächst immer die Möglichkeit haben, sich zu erfahrenen Kolleg:innen dazuzusetzen. Aber irgendwann müssen sie dann den Sprung ins kalte Wasser wagen.
IM+io: Wird es in fünf bis zehn Jahren noch Schiedsrichter:innen geben?
JD: Ich kann mir vorstellen, dass sich die Rollen ändern und vielleicht die Position der Schiedsrichterassistent:innen wegfällt, wenn es möglich wird, Abseitsentscheidungen in Echtzeit technologisch auszuwerten und die Information zu übermitteln. Dann wird sich die Frage stellen, ob
man tatsächlich noch zwei Assistent:innen an der Außenlinie braucht oder ob man vielleicht zu einem
System ähnlich wie im Handball übergeht, wo es zwei Schiedsrichter:innen gibt, die die Partie leiten. Wobei dann auch geklärt werden muss, wer welche Verantwortlichkeiten hat. Aber das ist ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte. Es muss aber in jedem Fall weiterhin mindestens eine Person geben, die das Spiel leitet und verantwortlich für die Entscheidungen ist. Es wird also definitiv auch in Zukunft noch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter geben.