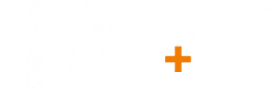Survival of the Digitalest?
Digitaler Darwinismus im Sport
Dirk Werth, Chefredakteur IM+io
(Titelbild: ©Adobe Stock | 487815465 | ME Image)
Haben Sie sich auch schonmal gefragt, ob in der Formel 1 der beste Fahrer oder das beste Auto gewinnt? Also, wieviel macht noch der Mensch und sein Können und wie viel die Technik aus? Diese Diskussion lässt sich inzwischen auf die meisten Sportarten und vor allem auf das Digitale übertragen. Denn in der erbarmungslosen Arena des Sports hat sich ein neues Gesetz etabliert: Survival of the Digitalest. Ähnlich dem Darwinismus in der Natur überleben hier nur die Stärksten und Anpassungsfähigsten. Doch heute manifestiert sich diese Anpassungsfähigkeit in der Integration und Nutzung neuer Technologien. Längst sind es nicht mehr allein die Muskeln und die Ausdauer, die den Unterschied ausmachen, sondern vor allem die Daten und Erkenntnisse, gewonnen durch fortschrittliche Technologien. Diejenigen Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainer sowie Teams, die sich weigern, den digitalen Wandel anzunehmen, riskieren, ins sportliche Abseits gedrängt zu werden. Doch Sensoren, Tracker und Co sind kein Merkmal des Profisports. Das Quantified Self begegnet uns auch in der nachbarschaftlichen Laufgruppe, unter Hobbyfußfußballern oder Gelegenheitsradfahrerinnen. Kaum jemand gibt sich noch mit Freude an der Bewegung als Motivation für sportliche Aktivität zufrieden. Analysen aus Schlaf, Training, Essgewohnheiten und vielem mehr geben uns die Möglichkeit, Potenziale in uns zu heben, von denen wir nicht wussten, dass wir sie verfolgen wollen, um uns zur besten Version unseres Selbst zu machen – wie es in den entsprechenden Werbeslogans gerne heißt. Die totale sportliche Überwachung ist salonfähig geworden. Macht uns die Digitalisierung zukünftig also alle zu Profisportlerinnen und Profisportlern?
Die Antwort kann nur ein klares „Nein“ sein. Denn zum einen gehören auch weiterhin Talent, Hingabe und hartes Training zum Erfolgsrezept eines jeden Athleten. Aber Digitalisierung wird zunehmend zur Grundbedingung für den Leistungssport, oder anders gesagt: Ohne konsequente Nutzung der Digitalisierung wird der Traum vom sportlichen Erfolg – egal, ob in der Hobbymannschaft oder dem Nationalkader – nicht gelingen; denn der sportliche Gegner nutzt die digitale Optimierung. Die Auswirkungen neuer Technologien auf die Sportarten selbst hingegen halten sich derzeit noch in Grenzen. Warum es beispielsweise in Sportarten wie Tennis und Badminton noch Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gibt, ist objektiv nicht zu erklären. Denn die künstliche Intelligenz ist in der Lage, Linienübertretungen und andere Schwarz-Weiß-Entscheidungen eindeutig zu erkennen. Und das sogar deutlich besser als jede und jeder noch so gut ausgebildete Offizielle am Spielfeldrand, denn die KI ermüdet nicht, ist zu 100 Prozent unparteiisch und korrekt. „Ist das Ziel denn nicht ein möglichst fairer Wettbewerb?“, lautet daher vielleicht Ihre Anschlussfrage. Die Antwort lautet: Doch, aber neben anderen Charakteristika ist der Sport vor allem eines, nämlich emotional. Freud‘ und Leid liegen auch hier nah beieinander und während die einen den Vorteil der Technologie bejubeln, beklagen die anderen den Verlust der Menschlichkeit. In dieser Auseinandersetzung zwischen Mensch und Maschine im Sport liegt die Essenz des digitalen Darwinismus: Die Fähigkeit zur Anpassung entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Doch letztendlich liegt es an uns, den richtigen Weg zu finden, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen – das Menschliche und das Technologische. Denn am Ende des Tages ist es nicht nur das Streben nach Siegen, sondern auch die Leidenschaft, die den Sport so unvergleichlich macht.