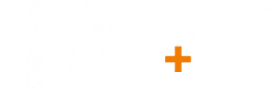Nächster Halt: Mobilitätswende
Mit digitalisiertem ÖPNV die Klimaziele erreichen
Christine Behle, ver.di
Kurz & Bündig
Die Digitalisierung ermöglicht eine integrierte Verkehrsinfrastrukturplanung, welche die Angebotsverdopplung im ÖPNV durch größere Fahrzeuge, Taktverdichtungen, Einrichtung von neuen Linien und Ausbau von Schienen- und Betriebsanlagen beinhaltet. Nicht zuletzt der Umwelt kommt eine solche Mobilitätswende zugute. Ein Problem, das allerdings nicht so einfach durch die Digitalisierung lösbar ist, ist der Fachkräftemangel.
Die Klimakrise verlangt, dass wir unsere Mobilität verändern, öffentlicher Verkehr und Fahrrad sind die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Wir wünschen uns Mobilität verlässlich, möglichst bequem, flexibel und zeitsparend und wählen danach unsere Verkehrsmittel aus. Zur Erreichung der Klimaziele müssen die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppelt und eine integrierte Verkehrsinfrastrukturplanung entwickelt werden.
Integrierte Verkehrsinfrastrukturplanung
(Bildquelle: AdobeStock | 111661215 | Golden Sikorka)
Digitalisierung ermöglicht uns umfassende, jederzeit verfügbare und leicht verständliche Fahrtauskünfte und senkt die Hürden zum Ticketerwerb. Elektronische Fahrplanauskunft, eTicketing und auch die Integration verschiedener Verkehrsmittel in den Apps der Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde sind ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Das novellierte Personenbeförderungsgesetz stellt die Weichen für die bundesweite Verfügbarkeit, an deren Umsetzung auch die Verkehrsunternehmen im Projekt Mobility Inside arbeiten.
Damit verbessert sich noch nicht das Angebot selbst, aber die Digitalisierung ermöglicht, Bewegungsströme zu erfassen, das Angebot bedarfsgerecht und intermodal abzustimmen. Darum geht es auch bei der integrierten Verkehrsinfrastrukturplanung. Ein Beispiel: Die Deutsche Bahn (DB) hat im Juni dieses Jahres angekündigt, 20 Strecken für den Bahnbetrieb zu reaktivieren. Das ist zu begrüßen, allerdings sollten Fahrgäste auch nach der Bahnfahrt eine attraktive Anschlusssicherung haben wie Park & Ride-Plätze an den Bahnhöfen, vor allem aber die Weiterreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Deutschlandtakt muss von abgestimmten integralen Taktfahrplänen im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) begleitet werden. Um die Verlagerungspotentiale zu heben, müssten durchgängige Mobilitätsangebote über Stadt-, Kreis- oder Landesgrenzen hinaus entwickelt werden. Das Umweltbundesamt identifiziert große Verlagerungspotentiale vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf den ÖPNV (bis zu 19 Prozent Anteil des ÖPNV am Modal Split), nennt aber als Voraussetzung eine übergreifende Verkehrsinfrastrukturplanung.
In Baden-Württemberg sind 70 Prozent der Landesfläche dem ländlichen Raum zuzuordnen, dennoch hat sich das Land die Verdopplung des ÖPNV bis 2030 vorgenommen. Im ländlichen Raum darf man sich künftig über einen garantierten Stundentakt in Hauptverkehrszeiten freuen. Mit einem 30 Minutentakt kann man in Ballungsräumen doppelt so häufig reisen. Dafür sollen verschiedene Verkehrsarten kombiniert werden und neben Bussen auch OnDemand-Dienste eingesetzt werden. Öffentliche Verkehrsunternehmen, Städte und Landkreise haben bundesweit über fünfzehn OnDemand-Angebote im ländlichen Raum und Randgebieten initiiert, die den ÖPNV erfolgreich ergänzen.
Die Mobilitätswende steht aufgrund der Siedlungsstruktur in Deutschland vor Problemen, die nicht alle sofort lösbar sind. Aber warum sollten wir nicht da starten, wo es einfach ist? Bauen wir doch den ÖPNV zunächst dort aus, wo Busse und Bahnen überfüllt und Städte verstopft sind und sich Staus auf Bundesstraßen bilden. Entspricht das ÖPNV-Angebot unseren Anforderungen an Mobilität, nehmen wir es als Alternative an.
Ein einmaliges Infrastrukturprogramm brächte die Wende. Für die Angebotsverdopplung durch Zubringer und größere Fahrzeuge, Taktverdichtungen, Einrichtung von neuen Linien und Ausbau von Schienen- und Betriebsanlagen wären über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2030 jährlich für die Infrastruktur fünf Milliarden und für zusätzliche Fahrzeuge zwei Mrd. Euro anzusetzen. Zum Abbau des Sanierungsstaus bei Betriebsanlagen und Leitsystemen sowie Modernisierungen für Barrierefreiheit und Digitalisierungsmaßnahmen sind insgesamt weitere zehn Mrd. Euro bis 2030 notwendig. Insgesamt geht es um Investitionen von etwa acht Mrd. Euro jährlich.
Mehr Lebensqualität in den Kommunen
Lebens- und umweltfreundliche Stadtplanung ist ein wichtiges Mittel, den Umstieg in den ÖPNV zu befördern. Zu gewinnen sind aber auch mehr Platz, reinere Luft, Hitzeeindämmung und Verkehrssicherheit. In der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie das Fahrradfahren komfortabler und sicherer wird. Während Paris 45 Kilometer neue Radwege umgesetzt hat, wird in Berlin schon wieder über den Bestand der 27 Kilometer Pop-up-Wege vor Gericht gestritten.
Integrierte Verkehrsinfrastrukturplanung bedeutet auch, Reiserouten über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus zu planen, denn viele Pendler leben im Umland. Um ihnen ein adäquates ÖPNV-Angebot zu machen, müssen sich die Behörden über Angebote ebenso wie über ihre Finanzierung verständigen.
Hierin liegt ein Kernproblem des ÖPNV in den Kommunen, dessen Finanzierung in Fachkreisen aufgrund der Vielzahl der Förderstränge auch gern als „Spagetti-Finanzierung“ bezeichnet wird. Als kommunale Aufgabe ist das Angebot öffentlicher Mobilität bisher von der kommunalen Kassenlage abhängig und unterscheidet sich stark. Hinzu kommen nun Einnahmeverluste durch Covid-19. Städte, Kommunen und Landkreise müssen die Mobilitätswende nachhaltig in Angriff nehmen und günstige öffentliche Mobilität als Daseinsvorsorge anbieten können, die direkt die Demokratiefestigkeit einer Gesellschaft stärkt. Die Finanzierung urbaner und regionaler klimafreundlicher Mobilität muss mit einem bundesweiten Finanzierungsprogramm und einer Investitionsoffensive durch die Länder und den Bund auf solide Füße gestellt werden. Als Geldgeber müssen sich diese den Kommunen keineswegs ausliefern. Schon heute sind Infrastrukturförderungen mit der „standardisierten Bewertung“ vom Nachweis der Wirtschaftlichkeit abhängig. Infrastrukturfinanzierung von Landes- und Bundesebene kann zukünftig auch an Umweltziele und Lebensqualität gebunden werden. Es stimmt, öffentlicher Verkehr kostet Geld. Aber das Verfehlen der Klimaziele kostet noch mehr. Der Bund hat die Klimaziele unterschrieben, nun muss er die Kommunen unterstützen, um sie zu erreichen.
Lösungen für den Fachkräftemangel
Eine besondere Herausforderung für den ÖPNV besteht im akuten Fachkräftemangel, der sich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Aufgrund jahrelanger Einstellungsstopps und Sparprogramme schiebt die Branche eine enorme demografische Welle vor sich her. Bis 2030 gehen nach Angaben der Branchenverbände etwa 100.000 Beschäftigte in den Ruhestand. Das betrifft über 60 Berufe, zunehmend auch im Bereich IT, Planung und Marketing. Außerdem entfallen aufgrund fortschreitender Digitalisierung und neuer Antriebstechnologien spezielle Ausbildungsformen/-verfahren im Bereich der Elektronik, der Informations- und Systemtechnik.
Fachkräfte zu rekrutieren, gestaltet sich schwierig. Das Gehalt, aber besonders fehlende Work-Life-Balance empfinden viele potenzielle Bewerber als unattraktiv. Im Vergleich zum Jahr 2000 fehlen heute 15.000 Arbeitskräfte, obwohl die Fahrgastzahlen um 24 Prozent gestiegen sind. So sind Überstunden die Regel und nicht die Ausnahme, besonders im Fahrdienst.
Autonomes Fahren wird in absehbarer Zeit mit großen Fahrzeugen wie Bussen im öffentlichen Straßenverkehr nicht zu erwarten sein. Aber auch Einsparungseffekte sind schwierig vorauszusagen. Eine aktuelle Studie des Freistaats Sachsen verweist darauf, dass mit Wegfall der Fahrenden neue Tätigkeiten entstehen. Die Erfahrungen bei der autonomen U-Bahn in Nürnberg zeichnen ein solches Bild. An die Stelle des Fahrpersonals sind Stationsmanager getreten, die für den reibungslosen Ablauf sorgen. Im internationalen Kontext sind bei Automatisierungen zwar Personaleinsparungen festzustellen, aber hier ersetzen die Stationsmanager das Servicepersonal auf Bahnsteigen, das es in Deutschland schon lange nicht mehr gibt. Maßnahmen zur Digitalisierung zielen überwiegend auf die Verbesserung des Service für Fahrgäste ab. Aufgrund der Struktur der Verkehrsunternehmen, die von der Verkehrsplanung über das Marketing, die Instandhaltung von Infrastruktur und Fahrzeugen bis hin zur Fahrleistung für den reibungslosen Ablauf alles selbst durchführen, sind die einzelnen Abteilungen verhältnismäßig klein. Einsparungen beim Personal sind kaum zu erwarten, Digitalisierungsprojekte verlangen vielmehr zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen. Automatisierung und Digitalisierung bergen derzeit keine Lösungen für die Behebung des Fachkräftemangels.
Allein zur Aufrechterhaltung des aktuellen Angebots muss der Fachkräftemangel dringend beseitigt werden. Es gibt lobenswerte Initiativen zur Rekrutierung von Fachkräften, wie der gemeinsame Stellenmarkt von Unternehmen mit aktuell über 3000 offenen Stellen. Es muss den Unternehmen aber auch ermöglicht werden, durch tarifliche Regelungen Arbeitsplätze und Entgelte attraktiver zu gestalten, um Bewerber anzusprechen und zu halten. Das ist nur möglich, wenn der finanzielle Rahmen im Bereich der Betriebskosten erweitert wird, sowohl für öffentliche wie auch für private Unternehmen, die sich im Ausschreibungswettbewerb behaupten müssen. Auch hier müssen die Kommunen durch zusätzliche Mittel von Seiten des Bundes und der Länder Unterstützung erhalten.