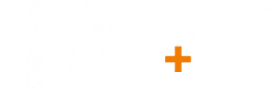Eine Identität für alles und jeden
Mit Self-Sovereign Identities zu mehr digitaler Selbstbestimmung
Benjamin Leiding, TU Clausthal
Kurz & Bündig
Im Gegensatz zu den klassischen zentralen Identitätsmanagementkonzepten ermöglichen Self-Sovereign Identities ein nutzergesteuertes Identitätsbereitstellungsmodell, bei dem die User den Zugriff und die gemeinsame Nutzung ihrer Daten auf der Grundlage des Wissensbedarfs mithilfe der Konzepte von DIDs, DID-Dokumenten und überprüfbaren Angaben steuern. Darüber hinaus können mittels DID-basierter SSI Systeme auch Identitäten für intelligente Maschinen und Software Services realisiert werden.
Beflügelt durch die fortschreitende und tiefgreifende Digitalisierung unseres Alltages werden auch traditionell-analoge Konzepte in die digitale Welt übertragen – z.B. Identitäten. Wobei wir in diesem Kontext nicht nur von menschlichen Identitäten sprechen, sondern den Begriff verallgemeinern und auch auf (intelligente) Maschinen, Software Services, etc. anwendbar machen. Ähnlich wie die analogen Identitäten sind auch deren digitale Gegenstücke sowie deren Transition hin zu digitalen Identitäten nicht frei von Problemen und Herausforderungen.
Infrastrukturen für öffentliche Schlüssel (Public Key Infrastructures – PKIs) sind nicht nur