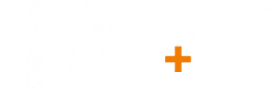Kurz & Bündig
Nachhaltige Geschäftsmodelle von Softwarefirmen haben im Kern Mietmodelle und kein Projektgeschäft mit ständigem Erfolgsdruck zur Akquise. Die Stellschrauben für Nachhaltigkeit sind wiederkehrende Umsätze, Wertschöpfung im Haus, Skalierbarkeit und die Vermeidung von Klumpenrisiken.
Nachhaltige Geschäftsmodelle in der Softwarebranche bedeuten im Kern eigene Produktentwicklung mit Mietmodellen und sind weniger Projektgeschäft oder Handel mit Fremdprodukten: eine strategische Aufgabe für den Unternehmer.
Lizenzkauf, Einführungsprojekt, jährliche Updates, Neukauf nach fünf Jahren – lange dominierte dieser klassische Lebenszyklus die Software-Branche, für Kunden und Hersteller gleichermaßen. Das traditionelle Geschäftsmodell der Entwickler fußt darauf, dass Software einmal programmiert und dann beliebig oft zu Minimalkosten kopiert wird. Vor einigen Jahren waren dafür noch gebrannte CD und bunt bedruckte Kartons notwendig, heute erfolgt selbst die Auslieferung von lokal zu installierenden Programmen online. Und oft entfällt auch das, da sie gleich vom Hersteller zentral in einem Rechenzentrum betrieben werden – und der Kunde nur noch mit einem Internet-Browser darauf zugreift – um 2000 mit ISDN-Geschwindigkeit, heute tausendmal schneller.
Dieser Trend hat direkten Einfluss auf Leistungsverantwortung und Kostenstrukturen der Anbieter sowie Planbarkeit für und Erwartungshaltung der Kunden, Abrechnungsmodelle, Distributionswege und mehr. Dies eröffnet Chancen, insbesondere für kleine und neue Anbieter.
Zentralbetrieb ändert Spielregeln
Die