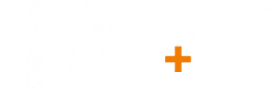Aus dem Elfenbeinturm in die Welt
Wenn Wissenschaftskommunikation politisch wird
Christian Humm, Universität des Saarlandes
(Titelbild: © AdobeStock | _273516159 | Thomas Heitz)
Kurz und Bündig
Schon immer hat sich Politik Rat bei der Wissenschaft geholt. Diese Politikberatung fand lange vor allem hinter verschlossenen Türen in Gremien statt. Durch den wachsenden Einfluss von Medien und Social Media, hat sich dies verändert. Politikberatung findet nun oftmals in der Öffentlichkeit statt. Gerade bei kontroversen Themen wird damit auch Wissenschaftskommunikation zu politischer Kommunikation. Deshalb ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass eine rein objektive und wertneutrale Beratung kaum möglich ist. Stattdessen sollte damit transparent und ehrlich umgegangen werden.
Traditionell fand wissenschaftliche Politikberatung hinter verschlossenen Türen statt. Dies hat sich in den letzten Jahren durch die Medialisierung von Wissenschaft und Politik stark verändert. Entsprechend findet auch Wissenschaftskommunikation nicht mehr in der isolierten Sphäre der Wissenschaft statt, sondern inmitten politischer und gesellschaftlicher Debatten. Wissenschaftskommunikation wird damit zu politischer Kommunikation. Aber was ist neutrale Wissenschaftskommunikation oder Politikberatung und was parteipolitische Lobbyarbeit? In welchem Maße sollten Wissenschaftler aktiv für politische Entscheidungen eintreten – oder sollten sie dies nicht tun?