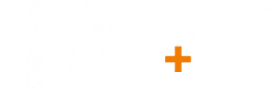Laden mit Weitblick:
Pflicht oder Chance?
Stephan Engel, SMA

(Titelbild: © Adobe Stock | 968659472 | ST22Studio )
Kurz und Bündig
Die Kombination aus Ladeinfrastruktur und erneuerbaren Energien bietet Unternehmen wirtschaftliche Vorteile. Neben CO₂-Einsparungen ermöglicht die Einbindung von Photovoltaik-Anlagen günstiges Laden und neue Erlösquellen durch den Verkauf von Ladestrom. Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) treibt den Ausbau der Ladepunkte voran. Zukunftstechnologien wie bidirektionales Laden könnten Elektroautos künftig sogar zur Netzstabilisierung einsetzen.
Die Parkplätze bleiben nicht mehr nur Stellflächen, sondern werden Teil der Energiewende. Immer mehr Unternehmen erkennen das Potenzial von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge – nicht nur als Service für Mitarbeitende und Kund:innen, sondern auch als wirtschaftlich sinnvolle Investition. Besonders in Kombination mit Photovoltaik ergeben sich neue Einnahmequellen und nachhaltige Vorteile. Doch wie lässt sich die Ladeinfrastruktur optimal in bestehende Unternehmensstandorte integrieren?
Die Elektrifizierung des Verkehrs ist ein wichtiger Schritt, um die Klimaschutzziele im Rahmen der Energiewende zu erreichen. Der große Vorteil von Elektroautos für dieses Vorhaben ist, dass sie lokal keine Emissionen verursachen und effizienter sind als Verbrenner. Allerdings verursachen Elektroautos aktuell im direkten Vergleich bei der Produktion noch zwei- bis dreimal mehr CO2, insbesondere durch die energie- und ressourcenintensive Produktion der Batteriezellen. Dies gilt es über die Lebensdauer des Fahrzeugs und hier insbesondere durch die Nutzung erneuerbarer Energien beim Laden zu kompensieren [1].
Gewerbliche Ladeinfrastruktur:
So profitieren Unternehmen
In diesem Kontext wird das Ladeverhalten immer wichtiger. Elektroautos müssen jederzeit auch unterwegs – etwa auf dem Supermarktparkplatz oder am Arbeitsplatz auf dem Firmengelände – geladen werden können. Mitarbeitende, die ihr E-Auto beispielsweise nicht an der eigenen Wallbox zu Hause laden können, profitieren von diesen Lademöglichkeiten (siehe Abbildung 1). Darüber hinaus kann das Unternehmen über den Verkauf von Ladestrom zusätzliche Einnahmen erzielen. Dies wird besonders attraktiv, wenn der Ladestrom aus erneuerbaren Energien wie etwa der firmeneigenen PV-Anlage kommt. Denn dann wird der Solarstrom vom Dach in Reichweite auf der Straße umgewandelt. Hinsichtlich des angesprochenen Ladeverhaltens kann schlussendlich so sogar noch ein Wettbewerbsvorteil gewonnen werden: Denn Unternehmen mit Verkaufsflächen und Kund:innenverkehr können mit Ladestationen auf dem Betriebsgelände punkten, wenn sie Kund:innen und Besuchende kostengünstige und klimaschonende Lademöglichkeiten vor Ort bieten.

Gesetzlicher Rahmen: Vorgaben als Chance nutzen
Mit den CO2-Flottengrenzwerten stellt die EU die Weichen in Richtung Klimaneutralität. Ab 2035 sollen in der EU ausschließlich emissionsfreie Kraftfahrzeuge verkauft werden dürfen [2]. Den dafür nötigen Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos regelt unter anderem das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG). Das GEIG gilt in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 und setzt Teile der EU-Richtlinien zur Energieeffizienz von Gebäuden aus dem Jahr 2018 um [3].
Bei Neubauten und umfassenden Renovierungen müssen nun Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge eingeplant werden. Auf Parkplätzen von Wohn- und Nichtwohngebäuden soll alles für die Installation einer Wallbox vorbereitet sein:
- Neubauten und größere Renovierungen: Unternehmen müssen sicherstellen, dass genug Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Bei Neubauten von Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen muss jeder dritte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet werden. Zusätzlich muss mindestens ein Ladepunkt errichtet werden.
- Bestandsgebäude: Eigentümer:innen bestehender Nichtwohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen sind verpflichtet, mindestens einen Ladepunkt zu installieren. Dies bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Gebäude schrittweise an die neuen Anforderungen anzupassen und gleichzeitig die Attraktivität für Mitarbeiter:innen und Kund:innen zu erhöhen.
- Quartierslösungen: Das GEIG ermöglicht es Unternehmen, Ladepunkt-Verpflichtungen an einem oder mehreren Standorten zu bündeln. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen mit mehreren Standorten, da sie so eine zentrale Ladeinfrastruktur aufbauen können.
Für Unternehmen wird die Elektromobilität so zum zentralen Bestandteil des nachhaltigen Wirtschaftens – und Gewerbeflächen werden mit moderner und leistungsfähiger Ladeinfrastruktur zukunftssicher aufgewertet.
Ökonomische und ökologische Vorteile: PV und Elektromobilität kombinieren
Wird diese Ladeinfrastruktur mit Einbindung von selbst erzeugtem Solarstrom betrieben, ergeben sich für Unternehmen noch weitere Vorteile:
- Umweltfreundliche Lademöglichkeiten schaffen
- CO2 Emissionen reduzieren
- Energiekosten senken
- Einnahmen durch den Verkauf von Ladestrom generieren
- Energiekosten der eigenen Fahrzeugflotte senken
- Attraktivität des Standorts erhöhen und Wettbewerbsvorteile schaffen
- Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgebende erhöhen
- Positive Abstrahleffekte auf das Unternehmensimage generell
Rein rechnerisch ergibt sich bereits eine Profitabilität für Unternehmen dadurch, dass sie den Ladestrom über öffentliche Ladestationen auf ihren Parkplätzen anbieten und zu höheren Preisen verkaufen können, als sie ihn selbst beziehen. Mit einer eigenen PV-Anlage etwa auf dem Firmendach ist das aufgrund der niedrigen Gestehungskosten für PV-Strom allerdings besonders rentabel. Denn die Nutzung überschüssiger PV-Energie für die eigene Ladeinfrastruktur erhöht die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage.
Weitere finanzielle Anreize bietet der Handel mit Treibhausgas-Quoten (THG-Quoten). Unternehmen, die ihre Fahrzeugflotte auf Elektroautos umstellen, können nicht nur ihre Mobilitätskosten senken. Betreibende der Ladestationen können darüber hinaus für die eingesparten Emissionen Geld erhalten. Bei gleichzeitiger Nutzung von lokal erzeugter erneuerbarer Energie kann sogar der doppelte Betrag beansprucht werden. Dies gilt derzeit nur für öffentlich zugängliche Ladepunkte im Sinne der Ladesäulenverordnung (LSV).
Ladeinfrastruktur-Projekte planen: Das ist wichtig
Die Planung der Ladeinfrastruktur sollte immer optimal auf den Bedarf des Unternehmens und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Für die Wirtschaftlichkeit der Anlage sind folgende Punkte relevant:
- Art der Ladepunkte, Wechselstrom- (AC) oder Gleichstromladen (DC)
- Anzahl der Ladepunkte
- Nutzungsmöglichkeit von selbst erzeugtem Strom aus der eigenen PV-Anlage
- Leistungsfähigkeit des Netzanschlusses
- Nutzungsprofile für unterschiedliche Ladezeitpunkte und -ziele (Mitarbeitende, Besucher:innen, Firmenfahrzeuge etc.)
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Beim Auf- oder Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ist der ganzheitliche Blick entscheidend. Oft sind eine PV-Anlage und ein Batteriespeicher eine sinnvolle Ergänzung. Neben den Ladepunkten als Hardware sind zum wirtschaftlichen Betrieb einer gewerblichen Ladelösung und beim Laden von Fahrzeugen zwei Komponenten besonders wichtig:
- Lastmanagement: Mit dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur steigt der Energiebedarf. Ziel des Lastmanagements ist es daher, teure Lastspitzen zu vermeiden und den Ausbau des Netzanschlusses zu verhindern. Es sorgt dafür, dass eine bestimmte Last nicht überschritten wird. Ein dynamisches Lastmanagement kann darüber hinaus sogar flexibel den Leistungsbedarf der Ladeinfrastruktur, der weiteren Verbraucher sowie die PV-Erzeugung in Kombination berücksichtigen. Elektrofahrzeuge können dann mit der maximal verfügbaren Ladeleistung geladen werden, ohne dass teure Lastspitzen entstehen oder der Netzanschluss überlastet wird. Je nach Ladezeit kann der anfallende Strombedarf kostengünstig durch Strom aus der eigenen PV-Anlage gedeckt werden. Ein Batteriespeicher kann als Puffer dienen, um auch dann günstigen Strom bereitzustellen, wenn die PV-Anlage keinen Sonnenstrom produziert. Intelligente Ladesysteme, die neben der Ladelast auch den Solarstromertrag berücksichtigen, können dabei nicht nur Lastspitzen vermeiden, sondern auch die Netzbelastung reduzieren. Das ist dann nicht nur für die Unternehmen als Betreibende der Ladeinfrastrukturen von Vorteil, sondern auch für die Netzbetreibenden, die so eine stabilere und effizientere Energieversorgung insgesamt gewährleisten können.
- Backend zum Abrechnen der Ladevorgänge: Ein weiteres wichtiges Element ist das sogenannte Backend, oft als CPO-Backend bezeichnet. CPO steht für Charge Point Operator, gemeint sind die Betreibenden der Ladepunkte. Über das Backend lässt sich die Ladeinfrastruktur einfach und aus der Ferne konfigurieren und überwachen. Hier erfolgt auch die Verwaltung der Nutzer:innen und die kilowattstunden-genaue Abrechnung der Ladevorgänge. Bei der Auswahl des passenden Backends ist wichtig, dass nicht nur das Laden und Abrechnen interner Nutzer:innen unterstützt wird, sondern auch Ladevorgänge gegenüber Dritten ermöglicht und abgerechnet werden können. So kann die Ladeinfrastruktur auch von Kund:innen, Besuchenden, Lieferant:innen etc. genutzt werden. Die zusätzlichen Einnahmen sorgen dafür, dass sich die Investition schneller bezahlt macht.
Ausblick: Wie Elektroautos zur
Netzentlastung beitragen können
Durch einen koordinierten Energiebezug und die Abgabe vor und hinter Engstellen im Stromnetz könnten in Zukunft gemeinsam gesteuerte Fahrzeugspeicher das Netz entlasten. Mit bi-direktionalem Laden würden vorhandene Flexibilitäten effizient genutzt werden. Energiemengen, die derzeit teuer durch Gaskraftwerke erzeugt werden, stünden dann dank einer Elektroflotte bereit. Elektrofahrzeuge könnten so zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur besseren Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Da die Energiekosten nach dem Merit-Order Prinzip von den teuersten Erzeugungsarten bestimmt werden, würden die Kosten dadurch für alle Beteiligten sinken [4].