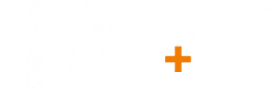Kurz & Bündig
Die neuen Technikwelten des autonomen Fahrens sind die alten: Seit den 1930er-Jahren verspricht man sich von selbstfahrenden Automobilen mehr Sicherheit, Zeit für Freizeit oder Arbeit sowie die Lösung von Verkehrsproblemen. Nun ist die Technik greifbar nahe und die Städte sind gefragt, das autonome Fahren so in den öffentlichen Raum zu bringen, dass es einen Nutzen nicht allein für die Fahrzeuginsassen, sondern für alle Menschen generiert.
Die ersten Visionen fahrerloser Fahrzeuge reichen zurück zu den Anfängen des Automobils. Doch erst in der jüngsten Vergangenheit ist die Technik so weit, dass autonomes Fahren greifbar wird. Dabei blieben die Technikwelten unverändert: Sicherheit, Zeit für Freizeit oder Arbeit sowie die Lösung von Verkehrsproblemen sind nach wie vor die gängigen Narrative einer Zukunft fahrerloser Automobile. Ob sich diese Visionen verwirklichen oder aber sich noch mehr Fahrzeuge auf unsere Straßen drängen, hängt maßgeblich davon ab, welchen Rahmen die Städte dem Verkehr der Zukunft setzen.