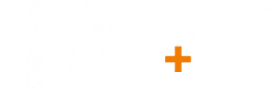Wenn "Doktor Google" krank macht
Zur Bedeutung von Cyberchondrie in der ambulanten Versorgung
Michael Jansky, Julian Wangler, Universitätsmedizin Mainz
(Titelbild: © AdobeStock | 318533939 | smile3377 AdobeStock | 506334816 | Aliaksandr Marko AdobeStock | 336546133 | Vjom)
Kurz und Bündig
Die Hausarztmedizin ist in spezifischer Weise von internetassoziierten Gesundheitsängsten betroffen. Empfehlenswert für Hausärztinnen und Hausärzte ist es daher, in der täglichen Sprechstunde mit ihren Patientinnen und Patienten die Potenziale und Risiken der Recherche aufzuklären. Mit diesem Umgang wird ermöglicht, dass Verunsicherungen vorgebeugt werden und zugleich Wertschätzung gezeigt wird, was zu einer positiveren Arzt-Patienten-Beziehung führt. Zudem sollte in Betracht gezogen werden, die Anamnese mittels (Online-)Informationssuche zu erweitern.
Die Zahl der Patienten, die mit online vorrecherchierten Informationen zu Krankheitssymptomen, Diagnosen und Therapien in die Sprechstunde kommen, steigt kontinuierlich an. Bei einem Teil dieser Patienten kann die übertriebene Suche im Internet zu längerfristigen Gesundheitsängsten führen. Gerade Hausärzte erleben die Cyberchondrie als wachsende Herausforderung im Praxisalltag – und haben sich Behandlungsstrategien zurechtgelegt.