KI, die Kreative Intelligenz jetzt in der neuesten Folge SMART&nerdy! Podcastfolge #23.
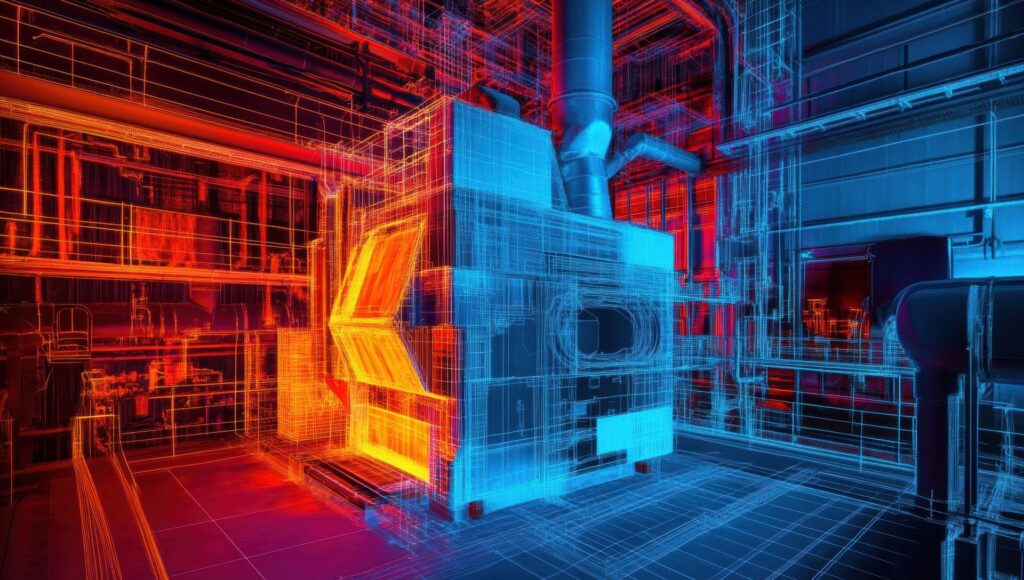
Shari Alt, Kim Jost, AWSi
Steigende Energiepreise, neue CO₂-Regularien und der Druck zu mehr Nachhaltigkeit führen zu einem Wandel in der Industrie: Statt maximaler Produktionsmenge stehen jetzt Ressourceneffizienz, Emissionssenkung und Transparenz im Fokus. Digitale Tools wie Chargenplanung und CO₂-Footprint-Tracking sorgen für bessere Auslastung, geringeren Energieverbrauch und erfüllen steigende Berichtspflichten. KI und datengetriebene Systeme ermöglichen dynamische Optimierung und wirtschaftliche Vorteile.
Brennöfen glühen, Algorithmen rechnen: Die Industrie steht an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der Daten nicht nur Prozesse steuern, sondern Entscheidungen mitprägen. Wie können intelligente Systeme und präzise CO₂-Bilanzen Produktionsalltag, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig stärken?
Die industrielle Wertschöpfung befindet sich in einem historischen Wandel. Energiepreise, volatile Lieferketten, wachsender Wettbewerbsdruck und nicht zuletzt die immer strengeren Anforderungen an CO₂-Transparenz und Nachhaltigkeit von Produkten zwingen Unternehmen zum Umdenken. Als Leitbild gilt nicht länger Effizienz im Sinne maximaler Produktionsvolumina, sondern eine zunehmend ganzheitliche Betrachtung von Ressourceneinsatz, Energieverbrauch, Umweltwirkung und Nachhaltigkeit. Insbesondere der CO₂-Fußabdruck von Produkten und Prozessen wird zum strategischen Differenzierungsmerkmal. In dieser Transformation rücken digitale Technologien in den Mittelpunkt. Wo früher manuelle Prozessregelung und punktuelle Energiesparmaßnahmen dominierten, entwickeln sich heute datengetriebene, intelligente Systeme, die in Echtzeit auf Verbrauch, Emissionen und Auslastung reagieren können. Die Industrie beginnt, sich selbst zu optimieren – datenbasiert, lernend und eingebettet in einen komplexen regulatorischen Rahmen.
Spätestens mit der Einführung des europäischen Emissionshandels für große Industrieanlagen (EU ETS) und des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) steigen die Anforderungen an CO₂-Datenqualität und -verantwortung. Ab 2026 müssen Unternehmen teilweise CO₂-Zertifikate auf Produktbasis nachweisen – ein Paradigmenwechsel, der ohne digitale Rückverfolgbarkeit nicht zu bewältigen ist. Klassische Methoden der Emissionsberechnung, die auf Jahresdurchschnittswerten und Branchenbenchmarks basieren, stoßen hier an ihre Grenzen. Gefragt sind präzise Emissionsdaten, die sich direkt aus dem Prozessgeschehen ableiten lassen. Hinzu kommen nationale Vorgaben wie das Energieeffizienzgesetz, das ab 2025 für große Unternehmen umfassende Energie- und Klimamanagementsysteme mit quantifizierbaren Einsparmaßnahmen vorschreibt. Auch die ISO 50005 zur schrittweisen Einführung von Energiemanagement in KMU oder das deutsche Strompreispaket für die Industrie setzen Anreize zur digitalen Effizienzsteigerung. Datengetriebene Prozessoptimierung wird damit nicht zur Option, sondern zur regulatorischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Notwendigkeit.
Daten werden dabei zum strategischen Rohstoff: nicht nur zu Dokumentationszwecken, sondern zur aktiven Steuerung und Optimierung. Sie sind längst nicht mehr nur Nebenprodukt der Produktionsprozesse, sondern rücken als aktiver Gestaltungsfaktor in den Mittelpunkt. Doch Masse allein ist nicht gleich Mehrwert. Erst die gezielte Analyse, Nutzung und bestenfalls Rückführung der Daten eröffnen das strategische Potenzial, das Unternehmen benötigen, um im Spannungsfeld aus Effizienz, Nachhaltigkeit und Regulatorik zukunftsfähig zu bleiben. Die zentrale Herausforderung liegt dabei nicht im Mangel an Daten – im Gegenteil. In vielen Produktionsbetrieben entstehen täglich tausende Datenpunkte zu Energieverbräuchen, Materialflüssen oder Prozesszuständen. Die eigentliche Frage lautet: Wie lassen sich diese Daten zusammenführen und Mehrwerte daraus generieren?
Mit genau diesen Herausforderungen hat sich das Forschungsprojekt OekoProOf (FKZ: 03EI5011C) beschäftigt. Das inzwischen abgeschlossene Forschungsprojekt wurde vom August-Wilhelm Scheer Institut gemeinsam mit einer mittelständischen Härterei und weiteren Industrie- und Forschungspartnern durchgeführt. Vor allem in thermisch intensiven Industrien wie der Wärmebehandlung und Metallveredelung, aber auch in der Glas-, Keramik- oder Lebensmittelverarbeitung sind Produktionszyklen energieintensiv und ressourcenabhängig. Steigende Energiekosten haben demnach gerade hier große wirtschaftliche Auswirkungen, und das Einsparen von Primärenergieverbräuchen hat große Relevanz. Zusätzlich herrscht oft ein hoher Druck der Kundschaft zum datenbasierten Nachweis der verursachten Emissionen. OekoProOf hat sich mit genau diesen Herausforderungen beschäftigt und hierfür zwei zentrale Lösungskomponenten entwickelt: das Chargenplanungstool und der CO₂-Footprint-Tracker.
Die Planung thermischer Prozesse ist eine hochkomplexe Aufgabe mit vielen Freiheitsgraden. Die oft noch manuell durchgeführte Planung stößt zunehmend an ihre Grenzen: Sollen gleichzeitig unnötige Heizphasen reduziert, Leerlauf minimiert und der Energieverbrauch gesenkt werden, lässt sich kaum noch auf datenbasierte Entscheidungsunterstützung verzichten.
Das Chargenplanungstool demonstriert eine solche datenbasierte Entscheidungsunterstützung für den Ofenbetrieb einer Härterei. Das Ziel des Tools ist es, die optimale Reihenfolge der zu härtenden Chargen festzulegen. Konkret bedeutet das: Für jede Charge wird automatisch berechnet, in welchem Ofen und zu welchem Zeitpunkt ihre Bearbeitung energetisch und prozesstechnisch am sinnvollsten erfolgt. Hierfür analysiert es historische und aktuelle Auftragsdaten (Temperaturen, Termine, Maschinenzustände) und berechnet die optimale Reihenfolge zur Minimierung von Temperatur-Deltas. Das Ergebnis: Energieeinsparung, geringere CO₂-Emissionen pro Charge und gleichzeitig verbessertes Zeitmanagement und Planbarkeit bei gleichbleibender Produktqualität. Entscheidungstransparenz und Effizienz werden so Hand in Hand realisiert.
Perspektivisch kann das Chargenplanungstool durch die Rückführung der Daten in ein adaptives, lernendes System weiterentwickelt werden. Damit können die Prozesse zukünftig nicht nur abgebildet, sondern selbstständig angepasst werden. Mit der kontinuierlichen Überwachung von Ofentemperaturen, Beladungszuständen, Materialdaten und Energieeinsatz können lernende Algorithmen automatisiert die vorliegenden komplexen Produktionssysteme erfassen und ganzheitlich weiterentwickeln.
Reinforcement Learning (RL) bietet neue Möglichkeiten zur Optimierung von Entscheidungen durch Rückkopplungsschleifen, also dem Abgleich von Handlung und Ergebnis. Reinforcement Learning, also bestärkendes Lernen, ist ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz, bei dem Algorithmen durch Ausprobieren und Rückmeldungen lernen, welche Entscheidungen in bestimmten Situationen zu den besten Ergebnissen führen. Ein RL-gestütztes Chargenplanungsmodul könnte beispielsweise in Echtzeit Temperaturanpassungen empfehlen, Ofenzyklen dynamisch anpassen oder reale Sensordaten zum eigenen Prognosemodell zurückspeisen. Über Trial-and-Error identifiziert der Algorithmus schon mit wenig manueller Steuerung Strategien, die Betriebskosten minimieren, CO₂-Emissionen verringern und Wartungszyklen verlängern können. Kurzum: ein KI-geführter Planungsagent, der auf Basis von Echtzeit- und Historie-Daten aus sich heraus bessere Prozessentscheidungen trifft – und ständig dazulernt.
Eine intelligente Prozessplanung geht Hand in Hand mit einer sauberen Dokumentation von Ressourceneinsätzen und der Erfüllung von Nachhaltigkeitspflichten. Um diesen Anforderungen der Kundschaft nach fundierten Informationen zu verursachten Ressourcenverbräuchen und damit CO2-Emissionen gerecht werden zu können, wurde in OekoProOf der CO₂-Footprint-Tracker entwickelt.
Der CO₂-Footprint-Tracker benötigt hierfür im Kern zwei unterschiedliche Datenquellen. Zum einen werden Informationen darüber benötigt, welche und wie viele Produkte wann und wo prozessiert worden sind und zum anderen braucht es Kenntnis darüber, wie hoch der Energie- und Ressourcenverbrauch im zeitlichen Verlauf für die unterschiedlichen Anlagen ist.
Durch das Verknüpfen der Informationen dieser beiden Hauptdatenbanken lassen sich Aussagen über den gemessenen Energieverbrauch während der Produktion einer bestimmen Charge treffen. Werden diese Informationen mit einer dritten Datenbank zu den spezifischen CO2-Umrechungsfaktoren gekoppelt, lassen sich datenbasierte Aussagen zu den verursachten CO2-Emissionen jeder einzelnen Chargen treffen. Damit kann nicht nur Nachweispflichten nachgekommen, sondern auch reflektiert werden, welche Auswirkungen beispielsweise die Nutzung von Energie aus PV-Anlagen oder Energiespeichern auf die Gesamtbilanz hat. Durch eine Verknüpfung des CO₂-Footprint-Trackers mit einem übergeordneten Auftragsmanagementsystem können die datenbasierten CO2-Emissionen je Charge beispielsweise auf Lieferscheine abgedruckt werden.
Die in OekoProOf entwickelten digitalen Tools ermöglichen es somit den wachsenden Herausforderungen hinsichtlich der Senkung von Primärenergieverbräuchen und den wachsenden Transparenzpflichten gerecht zu werden. Dabei beschränkt sich der Einsatz der Tools nicht nur auf die im Projekt betrachtete Branche der Wärmebehandlung, sondern lässt sich auf jegliche prozessgetriebene Industrie übertragen.
Das Potenzial datengetriebener Optimierung umfasst weit mehr als das Einsparen von Energie, auf das es häufig reduziert wird. Zukunftsweisende Ansätze zielen auf einen umfassenderen Wirkungsgrad: Sie verbessern die Resilienz gegenüber Energiepreisvolatilität, stabilisieren die lokalen Energienetze durch Lastverschiebung, schaffen Handlungsspielräume für Flexibilitätsvermarktung an (lokalen) Energiemärkten und verhindern ungeplante Stillstände. Konkret können beispielsweise Prognosen zur Entwicklung von dynamischen Strompreisen in die Prozessplanung miteinbezogen werden und, wo möglich, die Produktion in kostengünstige Zeiten verschoben werden, sodass Kostenersparnisse realisiert werden. Spiegelt der dynamische Strompreis zusätzlich die lokale Netzsituation wider, können durch solche Lastverschiebungen gleichzeitig auch die lokalen Energienetze entlastet werden. Daneben bietet die ganzheitliche datengetriebene Prozesssicht die Möglichkeit, Anomalien frühzeitig zu erkennen. Ein ungewöhnlich hoher Energieeinsatz pro Charge kann beispielsweise auf technische Defekte oder suboptimale Beladung hinweisen und damit ungeplanten Stillständen entgegenwirken.
Die datengetriebene Optimierung von Prozessen wird zum Fundament einer zukunftsfähigen Industrie. Sie steigert Effizienz, reduziert Emissionen und stärkt die Innovationsfähigkeit. Angesichts wachsender Regulierungen und Nachhaltigkeitsanforderungen wird die Fähigkeit zur dynamischen Prozessanpassung zum klaren Wettbewerbsvorteil. Wer diesen Wandel aktiv gestaltet, senkt nicht nur Kosten, sondern etabliert sich als Vorreiter einer klimaverträglichen, wertorientierten Industrie.
