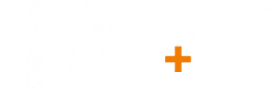Mit den technischen Möglichkeiten steigt auch das Bedürfnis zur Sammlung und Auswertung der Daten über das eigene Leben. Aussagekraft erhalten diese aber nur durch den Vergleich mit Daten der Mitmenschen. Damit entstehen neue Normen und Wertedarüber, wie man zu sein hat. Auf der Strecke bleibt dabei die Besonderheit und Einmaligkeit des einzelnen Menschen.
Schon der Held Robinson Crusoe im gleichnamigen Roman (1719) von Daniel Defoe bedient sich einer „modernen“ Technologie der Selbstvermessung: durch penibel geführte Listen legt er kalkulatorische Rechenschaft über die Vor- und Nachteile seiner Existenz als einsam Gestrandeter ab. Defoe liefert damit ein frühes Modell eines zielstrebigen Arbeitssubjekts, dessen Maßstab die vermessbare Nützlichkeit seines Tuns ist. Robinson kann trotz seines Schiffbruchs über die Angemessenheit seiner Kalkulation nur deshalb entscheiden, weil er erlernte Regeln aktiviert und den generalisierten Anderen mitdenkt. Die Gesellschaft ist also in Form von Vorstellungen über das Normale auch auf der einsamen Insel präsent.
1. Willkommen in der smarten Welt von Lifelogging
Rund 300 Jahre später sind wir gerade dabei, unsere Vorstellungen darüber, was „normal“ ist, an selbst erfasste Datenreihen und softwaregestützte Auswertungssysteme zu delegieren. Stellt man sich eine „Black Box“ vor, die alle nur denkbaren Daten(formate) über das eigene Leben enthält, so kommt dies einer Definition von Lifelogging – der digitalen Selbstvermessung und Lebensprotokollierung nahe. Nach und nach füllt sich diese „Black Box“ durch Tätigkeiten wie „tracken“ (Erfassung biometrischer Körper- oder Aktivitätsdaten) oder „loggen“ (visuelle Dokumentation des eigenen Lebensumfelds) mit Lebensspuren in digitaler Form. Damit ist Lifelogging eine mögliche technische Antwort auf die zentralen W-Fragen des Lebens: Was passiert wo mit wem und wie habe ich darauf reagiert? Unaufdringliche digitale Technologien in Form von Tracking-Armbändern, Smart-Watches, Apps und Mini-Kameras ermöglichen es, die eigene „Black Box“ zu füllen, ohne dem Prozess zu viel Aufmerksamkeit zu widmen.
Das Spektrum von Lifelogging-Anwendungen reicht dabei vom individuellen Gesundheitsmonitoring über kollaborative Heilversuche; von der Standorterfassung („Human Tracking“) von Kindern, Partnern und Angestellten bis zur Kontrolle von Demenzkranken und Senioren mittels Sensoren; von digitalen Gedächtnissen bis zu digitalen Avataren, in denen sich die Idee der Unsterblichkeit in einer zeitgemäßen Fassung zu aktualisieren scheint; vom digitalen Exhibitionismus bis hin zum (vermeintlichen) Schutz durch totale Datentransparenz („Sousveillance“) [1].
Quer durch alle Anwendungsfelder ziehen sich immense Heilsversprechen. Teils als Manifest verfasst bilden sie die „Philosophie“ eines Lifelogging-Jahrzehnts, an dessen Ende der neue Mensch stehen wird. Oder nach Wunsch von Google sogar ein neuer Gesellschaftsvertrag, der Bürgern im Tausch für umfassende Datentransparenz Vorteile und Belohnungen in vielerlei Lebensbereichen verspricht [2].
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum die proto-wissenschaftlichen Selbstexperimente mit privaten Daten gegenwärtig so beliebt sind? Die Antwort darauf bedarf eines Griffs in die Werkzeugkiste gesellschaftswissenschaftlicher Zeitdiagnosen.
Lifelogging ist das Ergebnis einer Ko-Evolution technischer Innovationen und sozialer Bedürfnisse. Digitalisierung, Miniaturisierung und Preisverfall bringen mittlerweile ein ganzes Arsenal an technischen Geräten und Gadgets für Selbstvermessungszwecke hervor. Aber eine angebotsinduzierte Erklärung des Phänomens greift zu kurz. Um Lifelogging als das zentrale Persönlichkeitsveredelungsprojekt des 21. Jahrhunderts zu verstehen, muss eine nachfrageinduzierte Perspektive eingenommen werden.
2. Ablösung analoger Selbstdisziplinierung durch digitale Selbstbeobachtung
Lifelogging hat zahlreiche historische Vorläufer. Hierzu gehören medizinische Selbstexperimente und Selbsterfassungen ebenso wie die Tabellierung von 13 „Tugenden“ im Tagebuch von Benjamin Franklin. Bereits die Hygiene- und Gesundheitsbewegung sowie die Leibesübungen der Philanthropen rückten den Körper in den Mittelpunkt. Durch Breiten- und Gesundheitssport erlangte die Körperfixierung weitere Legitimation.
Erstmals mussten sich breite Massen im Sog der Chronometrisierung einer fremdgesteuerten Disziplinierung unterwerfen. Uhren veränderten schleichend die Wahrnehmung der Welt sowie das Handeln und Zusammenleben. Sie erzwangen eine bis dahin nicht gekannte Nivellierung und Synchronisierung und bezeugen zugleich das Kernproblem jeder Vermessungsform: Die Zeit führt ein Eigenleben, Menschen dienen der Zeiterfassung und nicht umgekehrt.
Nicht zuletzt schwingt in uns allen noch immer eine Vorstellung eines „Ich“ mit, wie es in der klassischen Subjektphilosophie ausformuliert und in der Romantik erlebt wurde – ein Selbst mit einem expressiven Kern der Selbstverwirklichung, der anfällig für Entfremdungen ist und daher ständig bewacht, beobachtet und bearbeitet werden muss. Unmittelbar hieran schließen sich die individualisierten Nutzungsformen von Lifelogging an, bei denen es um „Self-Knowledge“ geht, um „Reflexionsschleifen“, um „Extensionen“ des Körpers und um die Ergänzung mangelhafter Sinnesausstattungen oder modern gesprochen um „Enhancement“ in Form von Selbststeuerung und Selbstoptimierung sowie Selbstemanzipierung durch die Erweiterung von Erfahrungsmöglichkeiten. Das romantische Ideal der Selbstvervollkommnung und Selbstüberschreitung schwingt noch immer in den „Konversionserzählungen“ der Self-Tracker mit. Immer geht es dabei um Selbsterziehung und -regulation, die (technologische) Erzeugung und Erfüllung von Selbstverbesserungsansprüchen sowie die Selbstdisziplinierung von Gefühlen oder Motivationssteigerung.
3. Die Endogenisierung von Risiken
Das Optimierungsnarrativ vermag indes das Auftreten des Lifelogging-Phänomens nicht vollständig zu erklären. Mit einem weiteren Griff in die zeitdiagnostische Werkzeugkiste wird sichtbar, dass Daten die Deiche der digitalen Gesellschaft sind. Sie schützen vor dem jähen Einbruch des Unbekannten und Unvorhergesehenen. Sie sind eine Reaktion auf eine „flüssige Moderne“ [3], in der Individuen ständig exogene Veränderungen und Einflüsse hinnehmen müssen, die sie nicht beeinflussen können. Aus der Resignation vor dem gefühlten Kontrollverlust moderner Risikogesellschaften in Form globaler Krisen resultiert eine Hinwendung zu denjenigen Feldern, die als endogen beherrschbar erscheinen. So kommt es zu einer Inversion der Perspektive auf das Innere und Kleine als das Beherrschbare. Es verwundert daher nicht, dass bei der Endogenisierung des Risikomanagements der eigene Körper und das eigene Leben im Mittelpunkt stehen.
4. Der Mensch als Lebendbewerbung und Ware
Diese Argumentationslinie wird ergänzt um den Aspekt der Kommodifizierung des Menschen, der zur Ware wurde und daher seinen Wert steigern oder zumindest erhalten muss. Schon in den 20er Jahren erkannte der Soziologe Siegfried Kracauer (1889 – 1966), dass der Besuch von Schönheitssalons nicht nur Konsum und Luxus bedeutete. Vielmehr sorgten sich die Menschen schon damals um ihre Marktfähigkeit. Heute sprechen wir vom „unternehmerischen Selbst“ [4] und ahnen, dass wir ständig als Lebendbewerbung unterwegs sind und uns in allen Belangen des Lebens steigern können oder müssen. Karriere und Erfolg brauchen Anpreisung, wobei das Wissen um das eigene „Ich“ zur Pflichtübung wird – so erklärt sich die Leitformel der Quantified Self-Bewegung „Self-knowledge through numbers“ als Triumph des neoliberalen Denkens im Alltag.
5. Schleichende Grenzverschiebungen
Liegt diese gesellschaftswissenschaftlich motivierte Diagnose nicht völlig daneben, müssen wir uns als Individuen und Gesellschaft auf zahlreiche Veränderungen einstellen: Das Alltagsgefüge wird sich in Richtung einer normengeleiteten Verantwortungsverlagerung verändern, wenn Leben nach einem durch Software erzeugten Anforderungskatalog geführt und organisiert wird. Generell wird es zu einer assistiven Kolonialisierung kommen, deren Basis die mehr oder weniger freiwillige Selbstvermessung darstellt. So werden beispielsweise Senioren großflächig mit Sensoren in ihrem privaten Wohnraum überwacht (Ambient Assisted Living). Vordergründig, um ihnen Sicherheit und Selbstbestimmtheit bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Tatsächlich aber kommt es zu einer Verlagerung der Fürsorge in technische Systeme und damit zu einer Betonung der Funktionssysteme als Entlastung für überforderte Angehörige. Dieses Beispiel zeigt nicht nur, wie eine fundamentale Ambivalenz – zwischen Kontrolle und Sicherheit – unauslöschbar in die Selbstvermessungstechnologien eingeschrieben ist, sondern auch, dass grundlegende Werte (hier: Fürsorge) sich durch sozio-technische Überformung schleichend wandeln.
Das Arbeitsgefüge wird sich in Richtung abstrakter Arbeit verändern und zu einer – in Anlehnung an Marx – Entfremdung 2.0 führen. Wenn Mitarbeiter sich an Leistungsprofilen (ver)messen oder Messreihen über Anstellung und/oder Karriere entscheiden, wird jeder lang erkämpfte Gedanke an „Diversity“ über Bord geworfen und durch eine Standardisierung von Beschäftigtenrollen ersetzt. Schon jetzt scheint die Idee von kreativen Mitarbeitern zu bloßer Rhetorik herabgesunken. Vielmehr werden Mitarbeiter benötigt, die nachweislich „funktionieren“ – wozu immer neue Messinstrumente und Formen von Rechenschaftsberichten ersonnen werden. Die Allgegenwart der Maschinenmetapher mit der gegenwärtig Menschen beschrieben werden, deklassiert Mitarbeiter im Kontext von „Industrie 4.0“ zum letzten zu eliminierenden Störfall.
Das Solidaritätsgefüge wird sich in Richtung rationaler Diskriminierung verändern, wobei die digitalen Versager (also Menschen, die sich der Selbstvermessung verweigern oder deren Idealwerten nicht entsprechen) zunehmend auf der Basis neu zu etablierender Steuerungsmechanismen als „Verliererklasse“ aussortiert werden. Die Ausdifferenzierung von erbrachten Leistungen über Evaluationen, Kennziffern, Rankings oder Indizes führt einerseits zu einer Überdehnung des Informationsgehalts von Zahlen und Messreihen. Andererseits wird damit aber ein neues universalistisches Prinzip der Vergewisserung über Zukünfte (von Schülern, Mitarbeitern, Konsumenten, Partnern) eingeführt. Durch die Privatisierung von Big-Data-Ansätzen kommt es gerade im Gesundheitswesen zu einer Ablösung institutionalisierter Solidaritätsgefüge auf der Basis von Kollektivverträgen. An deren Stelle stehen zunehmend individualisierte Vertragsverhältnisse. Die kalkulatorische Vorhersage geringer Risiken geht dann mit individuellen Belohnungen und Sanktionen einher und umgekehrt. In einem Betrieb, der über einen kollektiven „Health Score“ (als Mittelwert aller Mitarbeiter) bei einer Betriebskrankenkasse eingestuft wird, kann es nicht lange dauern, bis sich Kollegialität verflüchtigt und in Druck auf Einzelne umwandelt, die sich durch „abweichendes Verhalten“ auszeichnen. Erschreckend ist, für wie selbstverständlich inzwischen individualisierte Schuldzuweisungen empfunden werden und wie rücksichtslos Vertreter des Risikoäquivalenzprinzips darin ein Allheilmittel zur ökonomischen Stabilisierung von Märkten sehen. Um soziale Integration geht es dabei nie. Dieses Prinzip ist weit über das Gesundheitswesen hinaus verallgemeinerbar: Über den verobjektivierten Körper als Datenlieferant entscheidet die datengestützte Erfassung aller Lebensbereiche über Zugänge und Ausschlüsse, Vor- und Nachteile sowie soziale Anerkennung und Diskriminierung. Letztlich mündet dies in eine „Normalgesellschaft“, die sich nur noch über die Einteilung in Risikogruppen, krisenhafte Milieus und Problemgruppen steuern lässt.
Das Wissensgefüge wird sich in Richtung einer Überbetonung von Know-how bei gleichzeitigem Verlust von Know-why verändern. Die technisch mögliche Kategorisierung äußerer und selbst innerer Zustände (etwa durch „Moodtracking“) macht deutlich, dass prinzipiell alle biologischen Zustände hierarchisiert, entkontextualisiert und dadurch sozial vergleichbar gemacht werden können. Jede Form der digitalen Spurensicherung erweist sich damit als Form des praktischen Umgangs mit dem Körper. Selbstvermessung wird damit zu einem „Fenster in den Körper“, der durch Naturalisierung von einem Subjekt zu einem Objekt mutiert. Auf Deutungswissen und alternative Lesarten wird immer weniger Rücksicht genommen, je häufiger die selbst erhobenen Daten auf eHealth-Plattformen zum Vergleich bereit stehen und sich dezentrale, selbstregistrative Datenpraktiken mit zentralen, administrativen Sozial-, Gesundheits- oder Konsumstatistiken vermischen. Durch den Mangel an Deutungs- und Interpretationsfähigkeit kommt es aber letztlich zu einer normalisierenden Selbstverdatung und Homogenisierung gesellschaftlicher Praktiken, die eine übergreifende Sinnorientierung vermissen lassen.
Das Bewusstseinsgefüge wird sich in zeitlicher, ästhetischer und kognitiver Hinsicht in Richtung einer neuen Subjektmodellierung verändern. Noch nie verfügten Menschen über einen so tiefen Spiegel ihres Lebens. Aber die „Black Box“ leistet noch mehr: Life-logging ist begleitet vom Versuch einer dauerhaften Momentorientierung und Überhöhung des Augenblicks bei gleichzeitiger Vorratshaltung der Daten für alle Ewigkeiten. Dieses Leben in der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen verschiebt letztlich die Sinneswahrnehmung, fragmentiert das Alltagsbewusstsein und beraubt Letzteres um dessen synthetisierende Kraft, weil alle Eindrücke nur noch als „sinnlose“ Datenspuren nebeneinander vorliegen. Die neue Subjektmodellierung läuft auf einen Prozess der Umerziehung unseres Selbstverständnisses hinaus. Wenn eine Dublette des Menschen auf der Basis selbst erhobener Daten entsteht und in diesem Selbstverständnis gar die Möglichkeit des Weiterlebens als digitaler Avatar mitgedacht wird, dann zeigt sich spätestens dann, dass Angst die emotionale Grundierung des Selbstvermessungs-Booms darstellt. Latente Verlustängste (Gesundheit, Gedächtnis, Mobilität) unterliegen fast allen Manifesten der Lifelogger. Die objektivistische Verformung der Subjektivität hat Folgen für uns alle: Der Mensch wird zum Konformisten, blind für die Möglichkeiten eigener Entscheidungen, eigenen Denkens und Handelns.
Die Beziehungsgefüge werden sich in Richtung einer Umdefinition von Alltagssituationen und einer Abstraktion von Lebenssituationen unter dem Diktum der Daten verändern. Hierbei stehen vor allem Verdinglichungseffekte im Mittelpunkt. Das markanteste Beispiel dafür ist sicher die Vermessung der Liebe. Während John Gottman in seinem berühmten „Love Lab“ [5] noch ganz auf analoge Vermessungstechniken setzte, um die Geheimnisse einer stabilen Paarbeziehung zu ergründen, werden heute mühelos Apps eingesetzt, um den eigenen „Bangability Score“ (salopp etwa als „Bumsbarkeitsindex“ übersetzbar) zu ermitteln oder in Kombination mit Google Glass sich selbst durch die Augen des Partners beim Sex zu beobachten.
6. Versuch einer Gesamtdeutung
Der Boom der Selbstvermessung zeigt, dass sich vielfältige Ziele der Selbstbeobachtung in unlimitierten Datensammlungen abbilden. Wenn Daten aber zu Symbolen eines für sich selbst blinden Selbst werden und dies allgemein akzeptiert wird, sind wir mitten in der Aushandlung dessen, was in Zukunft ein Mensch ist oder zu sein hat. Eine Gesamtdeutung des Phänomens muss berücksichtigen, dass Lifelogging ambivalent ist: Dem emanzipatorischen Potenzial in einigen Bereichen steht ein autoritäres, ja vielfach totalitäres Potenzial in anderen gegenüber. Die überdrehte Neugierde an Daten über das eigene Leben verwandelt dieses in eine versachlichte, abstrakte, bereinigte Realität. In allen Domänen finden sich Homogenisierung, Nivellierung und Standardisierung durch welche die Vielfalt von Erfahrungsqualitäten verloren geht und es letztlich zu einer kulturellen Verarmung kommt. Dabei wird erlebtes Leben durch eine Rationalisierungsideologie ersetzt, die das Individuum zur selbstverantwortlich agierenden, sich dauerhaft beobachtenden Instanz macht. Das Problem der Heilslehren besteht darin, dass sie in ihrer Absicht Leid zu mindern, neues Leid schaffen.
7. Vom Zwang zu überlegen, was man besser machen könnte
Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend systemisch induzierte Verdinglichung fordert. Die Freiheit des modernen Menschen ist eine Fiktion. Aus den Datensammlungen wird gerade eine neue Form der Erwartbarkeit abgleitet. Und dabei kann es nicht nur Gewinner geben. Im Weltbestseller „The Circle“ von Dave Eggers (2013) beginnt der erste Arbeitstag der Protagonistin Mae mit einer Einführung in die Philosophie des smartesten Unternehmens der Welt, dessen Mitarbeiterin sie nun ist. Ein Trainer zeigt ihr, dass auf ihrem Bildschirm permanent eine Zahl zwischen 1 und 100 aufleuchtet – die Durchschnittspunktzahl der Bewertungen, die sie im Laufe des Tages von ihren Kunden erhält. Als sie den Trainer fragt, an welchem Durchschnitt sie sich orientieren solle, antwortet dieser: „Wenn der Durchschnitt unter 95 fällt, dann solltest du überlegen, was du besser machen kannst.“ [6]
So wie mit den Uhren die Pünktlichkeit als Tugend erst aufkam, eröffnen die Technologien der Selbstvermessung das weite Feld des Lebens nach Zahlen und damit neue, teils noch unbekannte Tugenden. Die Ausweitung des chronometrischen Prinzips mit zeitgenössischen Mitteln der Normierung passt hervorragend in das Programm der Gouvernementalität (Foucault), also der politischen Regierung der Selbstregulierung. Die letztendliche Funktion der Selbstvermessung ist kein Geheimnis. Kevin Kelly, einer der Mitbegründer der Quantified-Self-Bewegung, ist zugleich einer der zentralen Ideengeber der neoliberalen politischen Philosophie. Der erste Satz seines einflussreichen Werks „New Rules for the New Economy“ lautet: „Niemand entgeht dem verwandelnden Feuer der Maschine.“ [7] Dieses Feuer ist die neue ökonomische Rationalität, die in der Gegenwart die scheinbar alternativlose Grundlage des gesellschaftlichen Lebens ist. Die Selbstvermessungsbewegung zeigt, dass der Mensch dann zum Werkstück wird, wenn er es zulässt, den Wert seiner Arbeit durch scheinbar rationale und objektive Messreihen zu dokumentieren. Wenn Leben und Arbeit sogar mit Punkten gleichgesetzt werden, wenn Daten zur Sinnsuche gebraucht werden, dann sind wir auf dem Weg zu einem neuen Menschenbild. Denn dann werden aus „deskriptiven“ Daten, die soziale Ordnungen beschreiben „normative“ Daten, die neue soziale Ordnungen herstellen.
Selbstvermessung bedeutet das Durchlaufen hochspezifischer Trainingseinheiten zum Erlernen und Erwerb kulturell prämierter Eigenschaften. Die Trainingseinheiten sollen zur Selbstrationalisierung der Lebensführung beitragen. Was aber in diesen Trainingseinheiten nicht mehr vorkommt, ist das Erlernen des Umgangs mit Überraschungen, Geheimnissen, Intuitionen, Kontingenz. Um in der neuen versachlichten Realität in Form einer Zwangsöffentlichkeit zu leben, braucht es Zweisprachigkeit: Zählen steht neben Erzählen, Messen steht neben Ermessen. Diese Zweisprachigkeit sollte im kulturellen Kriterienkatalog eines fähigen Umgangs mit dem Leben nicht fehlen. Denn Leben ist nicht immer das, was man erwartet (oder berechnet), sondern vielfach ganz einfach das, was passiert.
Literatur:
[1] Selke, S.: Lifelogging. Wie die digitale Selbstvermessung unsere Gesellschaft verändert. Berlin: Econ. 2014
[2] Schmidt, E., Cohen, J.: The New Digital Age. Reshaping the Future of People, Nations and Business. London: Murray. 2013
[3] Baumann, Z.: Liquid Modernity. Cambridge: Polity. 2012
[4] Bröckling, U.: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.2007
[5] Gottmann, J., Silver, N.: Die Vermessung der Liebe. Vertrauen und Betrug in Paarbeziehungen. Stuttgart: Klett-Cotta. 2014
[6] Eggers, D.: The Circle. London: Penguin. 2013
[7] Kelly, K. zit. n. Schirrmacher, F.: Ego. Das Spiel des Lebens. München: Blessing. 2013. S. 227f.
Stefan Selke